Blog-Archiv: Corona | Krise | Unsicherheit
 Foto: Torsten Silz
Foto: Torsten Silz
Corona und Kritik
24. Januar 2022 | Prof. Dr. Uwe Vormbusch
Repräsentant*innen der gegenwärtigen Corona-Politik sind in den letzten Monaten Ziel von Schmähungen, Einschüchterungsversuchen und selbst Todesdrohungen geworden. Diese Angriffe werden in Form von Aufmärschen, die an die düsterste Zeit deutscher Geschichte erinnern, und über das Netz, insbesondere in Telegram-Chatgruppen organisiert. Einschüchterungsversuche und Todesdrohungen sind allerdings keineswegs erst mit den Corona-Protesten entstanden, denn so genannte Reichsbürger phantasieren sich bereits in eine Rechtsposition, in der sie Todesurteile gegen vermeintliche ‚Volksverräter‘ aussprechen zu können glauben (vgl. Rathje 2021). Vor diesem Hintergrund vermuten manche Beobachter der gegenwärtigen Krise weniger eine Zunahme, sondern lediglich eine vermehrte Sichtbarkeit von Aggression und Gewalt. So stellt Butter (2021: 10) fest, dass generell etwa ¼ bis ⅓ der deutschen Bevölkerung „empfänglich“ für Verschwörungstheorien und etwa 10 Prozent „überzeugte“ Verschwörungstheoretiker*innen seien. Dass der Anteil affiner oder gar aktiver Verschwörungstheoretiker*innen während der Pandemie zugenommen habe, lasse sich demgegenüber durch quantitative Studien nicht belegen. Eine stärkere Sichtbarkeit im öffentlichen Raum sei nicht mit größerer Popularität zu verwechseln. Aufmärsche, Verleumdungen und organisierte Fälschungen von Dokumenten wie z.B. von Impfpässen sind dabei ein Kampfmittel von Identitären, Reichsbürgern, radikalen Impfgegner*innen und anderen Anhängern eines gegen die bestehenden staatlichen Institutionen gerichteten „Souveränismus“ (vgl. Rathje a.a.O.). Hiermit sind explizit nicht diejenigen Menschen gemeint, die aus je eigenen Gründen und Überzeugungen skeptisch gegenüber Impfungen oder gar einer Impfpflicht sind, sondern aktiv staatsfeindliche Zusammenhänge, die im Kontext der Corona-Pandemie neue Diskurs- und Praxisstrategien der Subversion testen.
Zu diesen Strategien gehört auch, öffentlich vorgetragenen Protesten die Charakteristik einer Empörung zu verleihen, die unter Verweis auf die gesellschaftliche Marginalisierung der Empörten eskalierende Aggressionen rechtfertigt. Anders als zum Beispiel bei dem gewerkschaftlichen Kampf für die 35-Stunden Woche wird hier nicht im Sinne der Sozialkritik für ein positiv bestimmtes Ziel demonstriert, das sich in eine Fortschritts- oder Emanzipationsgeschichte einreihen soll. Von den angesprochenen staatsfeindlichen Gruppen wird stattdessen auf der Grundlage von Verschwörungstheorien und Geschichtsklitterung, also als Teil einer Verdachts- und Leugnungsgeschichte eine generalisierte Auflehnung gegen den Staat, gegen die deutsche Geschichte und gegen Einschränkungen der ‚Freiheit‘ eingeübt. In diesen Protesten, so Hoppe (2021), drücke sich vor allem das „Gefühl einer bedrohten Souveränität“ aus. Dabei bedroht die Corona-Politik mit ihren Ge- und Verboten lediglich eine spezifische Form der Ausübung von Freiheit, die man mit Ulrich Brand und Markus Wissen (2021) auch als ‚Imperialen Lebensstil‘ bezeichnen kann. Damit ist eine im globalen Norden verbreitete Lebens- und Denkweise gemeint, die zunächst auf der ökonomischen Ausbeutung des Südens und dem globalen Export von Armut basiert. In Maße, in dem dieser Lebensstil zum Maßstab des guten Lebens wird, verschwindet jedoch auch das Gefühl der Abhängigkeit von Anderen als eine basale menschliche Lebenserfahrung aus dem gesellschaftlichen Erfahrungshorizont. Der imperiale Lebensstil beruht also nicht allein auf Asymmetrien in der Macht- und Ressourcenausstattung, sondern ebenso auf einer kollektiven Verdrängungsleistung. Reziprozität, so könnte man das zusammenfassen, ist etwas für ‚Schwache‘. Es ist diese Verdrängungsleistung als eine Verdrängung der Abhängigkeit von Anderen, die mit Corona brüchig wird; Wenn Corona-Leugner und so genannte Querdenker für ‚Freiheit‘ und gegen staatliche ‚Gängelung‘ protestieren, dann, so Hoppe, sei die Leugnung der Abhängigkeit von Anderen der Kern ihres Freiheitsverständnisses. Man kann auch sagen, dass die spätimperiale Kernerfahrung, sich mittels des Marktes über die wechselseitigen Abhängigkeiten in der Begegnung mit Anderen hinwegsetzen zu können, eine Mentalität gefördert hat, die den Anderen nur noch als Marktsubjekt und damit letztlich als Ware konstituiert. Freizügigkeit, Flugverkehr, Autobahnen, globale Bezahlmöglichkeiten und Telekommunikationsstrukturen, die solcherart imperial strukturierte Erfahrungsräume scheinbar for free ermöglichen, erhalten dabei den Charakter einer geradezu selbstverständlichen Hintergrundstruktur. Corona aber ändert die frag- und mühelos gegebene Möglichkeit der Ausübung negativer Freiheiten radikal. Die Pandemie rückt stattdessen die Abhängigkeit eines von Abhängigkeit entwöhnten Selbst in den Mittelpunkt – Abhängigkeit von Menschen, von alltäglichen Begegnungen, von einer Infrastruktur, welche die Praxis des imperialen Lebens erst ermöglicht und nun für Reisen, Konsum und Dienstleistungen nicht mehr zugänglich ist. Auf dieser Ebene der Reaktion richtet sich die Empörung dementsprechend gegen den Staat, gegen jene Institution also, welche bislang als Garant imperialen Lebens diente und nun primär als disziplinierende Instanz wahrgenommen wird. Dies spiegelt sich durchaus auch in der Wortwahl der Politik selbst, in der stärker als früher davon die Rede ist, ‚konsequent durchgreifen‘ und Widerstände brechen zu wollen.
Von den unbewussten Verdrängungsleistungen der Krisenleugnung zu unterscheiden ist eine im weiteren Sinne epistemische Kritik, mittels derer die Herstellungsbedingungen und die Geltungsansprüche des virologisch-naturwissenschaftlichen Wissens problematisiert werden. Die Kritik an der Dominanz des naturwissenschaftlich-virologischen Wissens in diversen Beratungsgremien und Kommissionen, vor allem auch im öffentlichen Diskurs bildet hier die Grundlage der Skepsis gegenüber den politisch-administrativen Maßnahmen der Corona-Bekämpfung. Aus einer solchen Sicht ist die gegenwärtige Situation dadurch geprägt, dass die staatliche Corona-Politik zu einseitig auf Expertise aus den Natur- und Biowissenschaften setzt, also auf Virologie, Epidemiologie und Medizin. Das empirische Laborwissen wird durch entsprechend besetzte Gremien auf der Basis von Modellierungen einem upscaling unterzogen (vgl. Mitscherlich-Schönherr 2021), welches sich auf Berechnungen und Variablen stützt, aber das Wissen der Sozial- und Kulturwissenschaften um Konflikte und Brüche, Unsicherheiten und Ausgrenzungen, die Dynamiken von Autonomie und Missachtung nicht zu integrieren versteht. Die soziale Dynamik der Krise, die sich in Schule und Pflegeheim, Theater und Home-Office, bei den Alten und den ganz Jungen, bei den Vulnerablen und den sich radikalisierenden Skeptikern zuspitzt, wurde dabei zu lange zugunsten einer solchen ‚evidenzbasierten‘ Politik als ein Kollateralschaden betrachtet. Evidenz schert sich in diesem Sinne nicht um die Vulnerabilität der Menschen, ihr Zweck ist die Erhaltung des Lebens als solches – ungeachtet seiner Qualität, einer Größe also, die beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht zuverlässig modellierbar ist.
In der frühen Kritischen Theorie würde man die evidenzbasierte Corona-Politik als gegenwartsaktuelle Form einer instrumentellen Vernunft charakterisieren, in der Wahrheitsfragen nicht nur in bestimmter Weise (also auf der Grundlage von Daten) behandelt, sondern Wahrheits- und Sinnfragen prinzipiell in getrennten Sphären verhandelt werden (vgl. Schmidt 1986). Das ist interessant, weil Reichsbürger und neue Rechte in den Corona-Protesten vielleicht am lautesten schreien, sich dort aber gleichzeitig auch Sinnformen artikulieren, in denen normative und Wahrheitsfragen nicht getrennt voneinander sind, wie die Anthroposophie beispielsweise oder Reste der Umweltbewegung. In den Demonstrationen treffen also zu gleicher Zeit und am gleichen Ort sehr unterschiedliche Gruppen aufeinander: reaktionäre Elemente ebenso wie Kritiker*innen einer von normativen Deutungen getrennten und sich hiervon unabhängig verstehenden naturwissenschaftlichen Expertise. Die Proteste gegen Corona führen also zumindest teilweise Kritiken an einer Moderne zusammen, in der naturwissenschaftliches Wissen zum alleinigen Maßstab gemacht wird. Die Kritik am Denkstil einer ‚evidenzbasierten‘ Corona-Politik hat also vieles für sich. Allerdings läuft man mit Zuspitzungen wie z.B., dass in der Corona-Politik daran gearbeitet werde, „die Welt so weit wie möglich nach dem Modell eines Krankenhauses einzurichten“ (so Michael Niehaus im letzten Blog-Beitrag) Gefahr, die Falschen überzeugen zu wollen. Es ist zu befürchten, dass die hiermit bemühten Bilder Haltungen begünstigen, wir lebten tatsächlich in einer sich formierenden Gesundheitsdiktatur auf der Basis staatlich sanktionierten Bio-Wissens und entsprechender Disziplinierung der Bevölkerung – genau wie Juli Zeh, auf die Michael Niehaus sich bezieht, die Methode und Regierungsweise in Corpus Delicti literarisch beschrieben hat. Hierzu gehört jedoch eine diskursive Einstimmigkeit, wie sie in der gegenwärtigen Situation m.E. nicht beobachtet werden kann. Im Gegenteil: die Kritik im Sinne der Kritik an Validität und Angemessenheit Corona-spezifischer Kennziffern wie dem R- und dem Inzidenz-Wert gehört zum Alltagsgeschäft wissenschaftlicher Praxis und ihrer öffentlich-medialen Selbstdarstellung. Was jedoch angesichts des Leidens in Alten- und Pflegeheimen, des Sterbens auf Intensivstationen und der Eingriffe in die Lebenspraxis der Menschen immer noch zu zaghaft thematisiert wird, sind normative Fragen darüber, wie wir – auch angesichts der Bedrohung durch Corona – leben wollen. Diese Debatten erscheinen auch heute, gut zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, mehr oder weniger als ein Anhängsel des natur- und evidenztheoretisch gesteuerten containments. Stattdessen wäre öffentlich zu entschlüsseln, welche Formen des guten Lebens im Rahmen der Corona-Proteste zumindest implizit vertreten werden und wie sich diese Vorstellungen im Verhältnis zu einem naturwissenschaftlich-epidemiologischen Denkstil verhalten. Dies ist längst überfällig, um die Protestierenden nicht alle gleichermaßen in den großen Topf der naiven Leugner, der rechten Staatsfeinde und der verquasten Esoteriker zu werfen. Und es ist sinnvoll, um Kritiken an einer technisch-naturwissenschaftlich verarmten Moderne, die jetzt so deutlich wie nie hervortreten, als produktive Kritik an unserer heutigen Gesellschaft ernst zu nehmen: als Kritik an ihrer Medizin und ihrem Umgang mit Krankheit und Tod, als Kritik an der Ungerechtigkeit und der gleichzeitigen Ineffizienz globaler Ungleichheit, sowie als Kritik an ihren Naturverhältnissen und - im wahrsten Sinne des Wortes - ihren Lebensverhältnissen insgesamt.
Brand, Ulrich; Markus Wissen (2021): The Imperial Mode of Living: Everyday Life and the Ecological Crisis of Capitalism, London: Verso
Butter, Michael (2021): Verschwörungstheorien: eine Einführung, in: APuZ 71. Jg., 35–36/2021, S. 4-11
Rathje, Jan (2021): Reichsbürger und Souveränismus, in: APuZ 71. Jg., 35–36/2021, S. 34-40
Hoppe, Katharina (2021): Die Freiheit zur Verleugnung - oder: Keine Helden braucht das Land, online am 08.02.2021: https://www.fb03.uni-frankfurt.de/97527037/Die_Freiheit_zur_Verleugnung___oder__Keine_Helden_braucht_das_Land
Mitscherlich-Schönherr, Olivia (2021): Editorial: Das Gelingen der Künstlichen Natürlichkeit. Mensch-Sein an den Grenzen des Lebens unter den Bedingungen disruptiver Biotechnologien, in: dies. (Hg.): Das Gelingen der künstlichen Natürlichkeit, Berlin/Boston: de Gruyter, S. 1-20
Schmidt, Alfred (1986): Aufklärung und Mythos im Werk Max Horkheimers, in: Alfred Schmidt/Norbert Altwicker (Hg.): Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, S. 180-243
Vorschlag und Nachtrag zum Welt-Sepsis-Tag
24. September 2021 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Nach anderthalb Jahren Corona-Krise habe sich so viele so oft zu Wort gemeldet, dass alles dazu gesagt zu sein scheint. Die Reden über die verunsicherte und geängstigte Bevölkerung, die nicht mehr weiß, was sie glauben und woran sie sich halten soll, sind ebenso wiederholt worden wie die Reden über die unsicheren Prognosen und die Vorläufigkeit oder Strittigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Der Überdruss angesichts dieser Fixierung auf das Thema Corona ist nur allzu verständlich. Freilich: Die persönliche Angst bleibt, zumindest bei Vielen. Sie lässt sich, einmal aufgekommen und geschürt, wohl nicht mehr aus der Welt schaffen. Daher hier – aus aktuellem Anlass – ein Vorschlag, ihr wenigstens einen adäquateren Gegenstand zu verschaffen. Die Rede sei aber nicht die Angst vor einer „Gesundheitsdiktatur“ (mit Bedacht in Anführungsstriche gesetzt!), sondern vor der SEPSIS (mit Bedacht in Versalien gesetzt!).
Der aktuelle Anlass besteht darin, dass der 13. September der „Welt-Sepsis-Tag“ war. Sie wissen nicht, dass es so etwas gibt und was es damit auf sich hat? Damit stehen Sie nicht allein. Umso wichtiger ist es, die folgenden Ausführungen gründlich durchzulesen und zu bedenken. Der Welt-Sepsis-Tag wird seit dem 13. September 2012 begangen. Es gibt viele Websites, die darauf hinweisen (z.B.: worldsepsisday.org). In der Deklaration von 2012 heißt es: „Sepsis ist weltweit eine der häufigsten und gleichzeitig eine von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Erkrankung. Jährlich sind 20 bis 30 Millionen Patienten in Industrie- und Entwicklungsländern davon betroffen, darunter mehr als 6 Millionen Neugeborene und Säuglinge sowie über 100.000 Frauen im Wochenbett. Weltweit verstirbt nahezu jede Sekunde ein Mensch an Sepsis.“ (sepsis-gesellschaft.de). Im Volksmund heißt die SEPSIS Blutvergiftung. Das ist doch eigentlich ein würdiger Name, um daran Phantasmen aller Art anzuschließen. Medizinisch ist die SEPSIS eine überschießende Abwehrreaktion des Körpers, die durch die Schädigung des eigenen Gewebes und eigener Organe zu einem septischen Kreislaufschock und/oder Mehrfachorganversagen führen und tödlich enden kann (wikipedia.org).
Nach einer Statistik aus dem Jahr 2004/2004 erkrankten in Deutschland pro Jahr ca. 150.000 Menschen an einer SEPSIS, und rund ein Drittel starb daran, genauer: 36,4%. Zum Welt-Sepsis-Tag 2020 schrieb die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten: „Mit rund 75.000 Todesfällen pro Jahr ist die Sepsis […] die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.“ Das ZDF titelte aus Anlass einer Anfrage der Linken im Deutschen Bundestag vom 21.8. 2020 (bundestag.de) am Welt-Sepsis-Tag 2020: „94.000 Tote jährlich - Warum sterben so viele an einer Sepsis?“ (zdf.de). Das ZDF rechnet vor, dass das etwa 250 Menschen pro Tag sind. Es kommt aber eigentlich nicht darauf an, wie viele Menschen in Deutschland nun genau an einer SEPSIS sterben – mehr als an einer Corona-Infektion sind es auf jeden Fall (nur an ganz wenigen Tagen verstarben in Deutschland so viele Menschen an Corona wie an einem Durchschnittstag an einer SEPSIS).
Aber abgesehen davon sind die meisten Menschen, die an einer Corona-Infektion gestorben sind, zugleich an einer SEPSIS gestorben (man kann nämlich zwar – nach allem, was wir wissen – nur einmal sterben, aber unser Tod kann mehrfach gezählt werden; das versteht sich eigentlich von selbst, wird aber oft vergessen). Der Sepsis-Stiftung zufolge zeigt ein Viertel der Menschen, „die wegen einer COVID-19 Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, Zeichen einer viralen Sepsis“ und mehr als „75% dieser Patientinnen und Patienten müssen wegen des mit der Sepsis einhergehenden Versagens eines oder mehrerer Organe auf der Intensivstation behandelt werden.“ (sepsis-stiftung.de) Mit andern Worten: Corona-Tote sind in der Regel auch SEPSIS-Tote. In der Antwort der Bunderegierung auf die Anfrage der Linken heißt es lapidar: „Ein schwerer Krankheitsverlauf von COVID-19 kann als Sepsis gewertet werden. Dies wird derzeit in Studien näher untersucht. Der gegenseitige Einfluss auf die COVID-19-Letalitätsstatistiken bzw. die Sepsis-Statistiken kann derzeit noch nicht bewertet werden.“ (Drucksache 19/22137, vom 7.9. 2020)
Ohnehin ähneln die Krankheitsverläufe bei einer SEPSIS denen, die uns allen nun als schwere Verläufe bei einer Corona-Infektion geläufig sind. Das gilt zum einen für den meist langen Aufenthalt auf Intensivstationen, der dazu führt, dass die SEPSIS in den USA auf Platz eins der anfallenden Krankenhauskosten steht und in Deutschland „die direkten Behandlungskosten für Sepsis im ambulanten und stationären Bereich im Jahr 2013 auf 7.5 Milliarden Euro geschätzt“ wurden, aber angesichts der „langfristigen Folgen einer Sepsis […] wahrscheinlich deutlich höher“ liegen (wikipedia.org). Das führt zum anderen Punkt: den Spätfolgen einer SEPSIS-Erkrankung. „Erschöpfung und Fatigue, anhaltende Luftnot und Atembeschwerden, kardiale Einschränkungen, kognitive Schwierigkeiten wie Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, Muskel- und Kopfschmerzen“ – fast alle dieser „langanhaltenden Beeinträchtigungen in Folge einer Covid-19 Erkrankung“, für die man bekanntlich den Begriff „Long-Covid-Syndrom“ gefunden hat, sind auch Folgen einer SEPSIS. Sie „wurden in den USA schon vor mehr als 10 Jahren als versteckte Gesundheitskatastrophe bezeichnet und jüngst als ‚Post-Sepsis-Syndrom‘ und damit als eigenständiges, komplexes chronisches Krankheitsbild charakterisiert.“ (sepsis-stiftung.de)
Das heißt nicht, dass eine einfache Corona-Infektion mit einer SEPSIS vergleichbar wäre. Nur die sehr schweren Verläufe sind es. Schließlich hat die SEPSIS eine Sterberate von etwa einem Drittel, und für die anderen beiden Drittel, die noch einmal davongekommen sind, ist das Leben nicht mehr so wie zuvor. Und wer genauer wissen will, wie es sich anfühlt, eine SEPSIS gehabt zu haben und noch einmal davongekommen zu sein, kann es etwa in dem Buch Alptraum Sepsis: Aufgeben wollte ich nicht von Arne Trumann aus dem Jahr 2019 nachlesen. Nur haben eben solche Erfahrungen nicht die mediale Aufmerksamkeit erfahren wie derzeit die ausführlichen Präsentationen des Long-Covid-Syndroms. Die Wahrscheinlichkeit eines jeden von uns, an einer SEPSIS ohne Corona-Infektion zu sterben, ist eindeutig größer als die, an einer SEPSIS mit Corona-Infektion zu sterben. Trotzdem steht den meisten allein die Angst vor einer Corona-Infektion vor Augen. Es handelt sich um ein eklatantes Beispiel falscher Risikoeinschätzung, d.h. mangelnder Risikokompetenz. Das ist seit langem bekannt und hat mehrere Gründe; aber der entscheidende Grund sind die Medien. Natürlich schätzen wir neue Gefahren anders ein als bereits seit Langem bestehende Risiken. Der bekannteste deutsche Risikoforscher, Gerd Gigerenzer, wies in Anbetracht der Corona-Pandemie im Oktober 2020 auf die 25.000 Grippe-Toten hin, die „wir vor zwei Jahren nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts hatten. Diese Menschen bekamen keine Aufmerksamkeit, weil Grippe etwas ist, das alle Jahre wiederkommt. Die menschliche Psyche fürchtet sich besonders vor neuen Gefahren.“ (rheinpfalz.de) Und die ‚menschliche Psyche‘ fürchtet sich auch, wie Gigerenzer in dem Buch Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, ausführt, vor dem Ereignishaften. Die „unbewusste Faustregel“ laute: „Wenn viele Menschen gleichzeitig sterben, reagiere mit Furcht und vermeide die Situation.“ (Ebd., München 2013, S. 23) Beide Faktoren werden durch die mediale Darstellung in spezifischer Weise verstärkt. Die Neuartigkeit und die Gleichzeitigkeit werden auf eine ganz besondere Weise hervorgehoben und isoliert betrachtet und ereignishaft verdichtet, wodurch die Risikokompetenz des Einzelnen schwer beschädigt wird. Aber, wie es ebenfalls bei Gigerenzer heißt: „Risikokompetente Bürger sind die unverzichtbaren Säulen einer Gesellschaft, die bereit ist zur positiven Freiheit“ (ebd., S. 29).
Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Die SEPSIS, so scheint es, nehmen wir gleichsam als Schicksal hin. Man sagt: „Eine Sepsis kann jeden treffen.“ Keiner kann sich sicher fühlen, auch wenn wie immer die Alten und die Kranken besonders gefährdet sind, und die SEPSIS gerade für kleine Kinder viel gefährlicher ist als eine Corona-Infektion (nachrichten.idw-online.de). Die Hinweise gehen daher vor allem dahin, bei den ersten Symptomen einer Sepsis schnell zu handeln. Das ist aber leichter gesagt als getan, weil gerade „in der Anfangsphase die Symptome schwer zu erkennen“ sind, „da die Beschwerden oft unspezifisch sind, also auch von anderen Erkrankungen hervorgerufen werden können“ (zurueck-ins-leben.de). Das ist der Unterschied zu einer Corona-Infektion! Es ist fast nur von den Maßnahmen die Rede, die getroffen werden müssen, wenn man die Sepsis schon hat (und eine zentrale Forderung der Forschungen und Verbände geht dahin, SEPSIS als einen akuten Notfall anzuerkennen – vgl. medizin.uni.greifswald.de). Die Maßnahmen hingegen, um einer Sepsis vorzubeugen, spielen kaum eine Rolle. Man kann sich ja nicht mit einer SEPSIS anstecken! Richtig. Aber gleichwohl beruht eine SEPSIS auf einer Infektion. Achtung: „Jede Infektion im Körper […] kann eine Sepsis auslösen.“ (patientenbeauftragte.de) Da kann der Staat nicht viel machen, und deswegen redet er auch nicht so viel darüber (und die Medien folgen ihm darin nach). Gegen SEPSIS kann es natürlich auch keinen Impfstoff geben. Das müsste ja ein Impfstoff gegen Infektionen überhaupt sein! Weil das so ist, verdient die SEPSIS es, in Versalien geschrieben zu werden.
Am meisten wird noch über die sogenannten nosokomialen Infektionen gesprochen. Das sind Infektionen, die man sich dort zuzieht, wo man eigentlich gesund gepflegt werden sollte – also Krankenhausinfektionen. Sie hängen nicht nur mit multiresistenten Keimen, sondern auch mit SEPSIS eng zusammen. Über die Häufigkeit solcher nosokomialen Infektionen in Deutschland gibt es verschiedene Schätzungen; sie reichen von etwa einer halben bis einer Million Fällen pro Jahr. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene geht von 900.000 Fällen aus, von denen etwa 30.000 Fälle tödlich verlaufen (wikipedia.org). Bei den tödlich verlaufenden Fällen spielt dann die Sepsis eine zentrale Rolle: „Die nosokomiale Sepsis wird oft als die Crux der modernen Intensivmedizin bezeichnet“, heißt es im einschlägigen Wikipedia-Artikel.
Da die Statistiken Deutschland in dieser Hinsicht kein glänzendes Zeugnis ausstellen, gibt es immer wieder eingeforderten Handlungsbedarf, der insbesondere die Krankenhaushygiene betrifft. Vor allem den Krankenhäusern und Arztpraxen sei es zuzuschreiben, dass es nicht 20.000 SEPSIS-Tote pro Jahr weniger gibt, wie die ÄrzteZeitung im Februar 2021 titelt (aerztezeitung.de). In Krankenhäusern sollte das Menschenmögliche getan werden, um bakterielle Infektionen zu verhindern. So bietet es sich beispielsweise an, alles, was häufig berührt wird (Türklinken, Fenstergriffe, Toilettenspülungen usw.), aus antibakteriellem Kupfer anzufertigen. Also könnte man, wenn sich die Angst tatsächlich auf den immerhin adäquateren Gegenstand SEPSIS verschöbe, doch Maßnahmen ergreifen! Man müsste dann daran arbeiten, die Welt so weit wie möglich nach dem Modell eines Krankenhauses einzurichten; man müsste dann danach trachten, Infektionen überhaupt zu verhindern, wie es in dem Roman Corpus Delicti von Juli Zeh bekanntlich der Fall ist. Dann könnten wir uns so sicher fühlen wie im Krankenhaus. Insofern kann der Vorschlag, sich statt vor Corona lieber vor einer SEPSIS zu fürchten, nicht ernst gemeint sein. Man sollte seine Angst lieber auf die Furcht vor einer solchen Gesundheitsdiktatur ohne Anführungszeichen verschieben.
„Das ist unstrittig“
10. Juli 2021 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Unser Blog soll sich mit der Pandemie unter dem Aspekt der Unsicherheit beschäftigen. Nun naht der Sommer, die Infektionszahlen gehen zurück, das Impfen ist im vollen Gange, es gibt Lockerungen allenthalben und alle stellen uns bessere Zeiten in Aussicht. Soll man da jetzt, wo sich ‚die Leute‘ alle endlich ein wenig sicherer fühlen, erneut mit der Unsicherheits-Leier anfangen? Als Medienbeobachter muss man sagen: auf jeden Fall, und vielleicht gerade jetzt. Vielleicht kann man inzwischen etwas besser überblicken, wie in der Vergangenheit, in der alle verunsichert waren, mit Unsicherheit umgegangen wurde. Dazu hier eine kleine Beobachtung nebst einigen Schlussfolgerungen. Es handelt sich um Schlussfolgerungen, die jedem eingeräumt oder von jedem bestritten werden können, der sich – nach Kant – seines „eigenen Verstandes zu bedienen“ weiß, und die in keiner Weise mit dem Anspruch verbunden sind, etwas besser zu wissen bezüglich der „Studien“ und „Metastudien“, auf die sich die empirischen Wissenschaften und die Politik in der Öffentlichkeit zunächst und zumeist beziehen.
Am 6.5. 2021 sagte Karl Lauterbach, der in der medialen Öffentlichkeit bekanntlich in ausgezeichneter Weise als Politiker und Epidemiologe sprechen darf, bei Maybrit Illner im ZDF: „Sieben Prozent der Kinder – das ist unstrittig –, die sich infizieren, entwickeln Long-Covid-Syndrome, das ist keine Kleinigkeit.“ Man kann sich dieses Wortlauts gerne versichern (Video bei YouTube, etwa nach 16 Minuten fällt der Satz). Natürlich wurde diese Aussage in verschiedenen Medien aufgenommen, sie wurde weitergetragen, kommentiert – und natürlich bestritten. Im Folgenden soll es in erster Linie nicht darum gehen, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. Das könnte man auch nur beurteilen, wenn man wüsste, was sie bedeutet – da es aber gar keine klare Definition von Long Covid zu geben scheint, ist das gar nicht möglich. Insofern besteht ein erster Einwand gegen diese Aussage darin, dass der Anschein erweckt wird, eine klar definierte Bedeutung zu haben. Das ist allerdings ein Einwand, der gegen sehr viele in dieser Pandemie getätigten Aussagen vorgebracht werden kann. Interessant ist viel mehr die Frage, was es – darüber hinaus mit dem Einschub „das ist unstrittig“ auf sich hat. Dass das, was Karl Lauterbach als unstrittig deklariert, nicht unstrittig war, müsste man ja schon aus der anschließenden Diskussion schließen können: Das, was als sicheres (d.h. wissenschaftlich abgesichertes) Wissen präsentiert wurde, hat sich als durchaus unsicher erwiesen.
Wie ist dieser Einschub dann zu interpretieren? Erste Möglichkeit: Karl Lauterbach war wirklich der festen Überzeugung, dass seine Behauptung unstrittig ist. Dies würde seiner Kompetenz nicht das beste Zeugnis ausstellen. Weder seiner Kompetenz als Politiker noch seiner Kompetenz als Wissenschaftler. Als Politiker muss er wissen, dass alles bestritten wird; als Wissenschaftler muss er wissen, dass schon wegen der Definitionsschwierigkeiten von Long Covid eine solche Behauptung alles andere als sicher ist. Nehmen wir also – zweite Möglichkeit – an, dass er die Unstrittigkeit seiner Behauptung wider besseres Wissen nur behauptet. Das heißt nicht, dass er bewusst die Unwahrheit sagt. In gewisser Weise ist er womöglich – wie man die Sache deuten könnte – in diesem Moment sogar besonders wahrhaftig. Denn er meint ganz ehrlich, dass diese Behauptung unstrittig sein müsste. Natürlich handelt es sich um einen Versuch, Sicherheit dort vorzuspiegeln, wo es keine Sicherheit gibt. Und dies geschieht im Namen der Wissenschaft, der auf diese Weise attestiert wird, nach rein wissenschaftlichen Prinzipien vorzugehen. Lauterbach wird wohl kaum geglaubt haben, dass seine Aussage nicht bestritten wird. Insofern liegt die Schlussfolgerung nahe, dass er diejenigen, die diese Aussage bestreiten würden, von vornherein für diskreditiert hielt: Unter wirklichen Wissenschaftlern ist diese Aussage unstrittig. Es geht dann ein weiteres Mal darum, eine Grenze zu ziehen, und abweichende Stimmen aus dem wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen, sie vorab zu delegitimieren. Zumindest in der Öffentlichkeit soll der Eindruck herrschen, es gebe – zumindest im Prinzip – die Wissenschaft mit ihren sicheren Erkenntnissen.
Es lohnte der Mühe nicht, auf diesen drei Worten herumzuhacken, wenn sich in ihr nicht eine sehr allgemeine diskursive Logik verdichtete, die das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Medien betrifft. Man könnte ja sagen: Nun gut, das war ein kleiner Ausrutscher, eine etwas überzogene Behauptung usw. Aber es kommt hier eben nicht nur eine bestimmte Geisteshaltung verdichtet zum Ausdruck, sondern im Zusammenspiel dieser drei Größen werden bestimmte Aussagen der Diskussion entzogen. Damit entsteht der Eindruck, dass es dort sichere Entscheidungsgrundlagen gibt, wo es sie in Wahrheit nicht gibt. Soll man die ohnehin schon verunsicherten Bürgerinnen und Bürger auch noch zusätzlich durch das Eingeständnis verunsichern, dass auch die Entscheidungsgrundlagen unsicher sind? Denn Entscheidungen müssen ja getroffen werden. Und da jeder weiß, wie unsicher alles ist, sollte man wenigstens versuchen, so viel wie möglich als sicher auszuweisen. Es hat ja auch keiner in der Gesprächsrunde bei Maybrit Illner Einspruch gegen Lauterbachs anmaßende Unstrittigkeitsbehauptung erhoben – etwa die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, die mit am Tisch saß. Die Vorstellung, dass sie das getan hätte, mutet ausgesprochen merkwürdig an: So funktionieren derartige Gesprächsrunden eben nicht. Ihr Zweck besteht nicht darin, die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären. Diese sollen vielmehr gleichzeitig in Angst versetzt (so unabsehbar sind die Folgen der Infektion sogar bei Kindern) und versichert werden (wir haben sichere Erkenntnisse, aus denen wir Maßnahmen ableiten können).
Die Wochenzeitung DIE ZEIT stellt in ihrer Ausgabe vom 2. Juni 2021 in dem zum Titelthema der Woche gehörigen Artikel Soll mein Kind geimpft werden? fest, dass das „Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder gar zu sterben, […] für Kinder extrem gering“ sei. Was die „Langzeitfolgen“ einer Infektion angeht, wird der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, zitiert, der den Verweis auf diese Langzeitfolgen für eine „Instrumentalisierung der Sorge“ halte. „Covid-19“, so Mertens weiter, „ist bei Kindern nicht bedeutsamer als die Grippe, was die Rate an schwer Erkrankten und Krankenhauseinweisungen angeht“ (DIE ZEIT, 2. Juni 2021, S. 31). Nun geht es an dieser Stelle gar nicht darum, ob Mertens mit seiner Feststellung recht hat und Lauterbach demzufolge mit seiner widersprechenden Behauptung unrecht. Was diejenigen, die nicht die höheren Weihen der Lektüre wissenschaftlicher Studien erhalten haben, davon zurückbehalten, ist zumindest die Strittigkeit des von Lauterbach als unstrittig Behaupteten. Das Problem besteht nicht darin, dass es solche und solche Studien gibt und dass die Lage daher ungewiss ist, sondern dass eine spezifische Dynamik im Zusammenwirken von (empirischer) Wissenschaft, (praktischer) Politik und (öffentlich-rechtlichen) Medien dazu führt, möglichst viel als unstrittig auszuweisen, also dem Streit zu entziehen. Ob man damit dem Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger entgegenkommt?
Auf jeden Fall hatten die Erkenntnisse, die als fundiert und sicher oder sogar als unstrittig ausgewiesen worden sind, eine Tendenz: Im Zweifelsfall ist es besser, den Adressaten den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Jetzt, im Zeichen des Sommers und der sinkenden Infektionszahlen, erscheinen auf einmal andere Studien auf der Bildfläche. Nachzulesen etwa in einem anderen Artikel in der ZEIT vom 2. Juni 2021 mit dem Titel Zu Unrecht verdächtigt. Kinder als Pandemietreiber? Aktuelle Studien zeigen das Gegenteil: Sie tragen kaum zum Infektionsgeschehen bei. Plötzlich gibt es also Studien, die belegen, dass die Kinder zu Unrecht verdächtigt worden sind. Die gibt es aber nicht erst seit dieser Woche. Die gab es auch schon vorher. Sie lassen sich auch im Nachhinein noch leicht aufspüren – man schaue sich nur einen Artikel im sicherlich nicht unseriösen Deutschen Ärzteblatt mit dem Titel COVID-19 in Schulen: Keine Pandemie-Treiber vom Dezember letzten Jahres an. Nur wurden solche Studien Zusammenspiel von Politik, Wissenschaft und Medien an den Rand drängt, ausgeschlossen oder gar stigmatisiert (wo sie dann folgerichtig dem unheilvollen Gebräu der Corona-Leugner einverleibt wurden). Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Resonanz auf das Positionspapier und den offenen Brief der Gesellschaft für Aerosolforschung an den Bundesgesundheitsminister vom 11. April 2021 – der Hinweis auf Studien, denen zufolge nur ein Promille der Infektionen draußen stattfindet, verhallte nahezu ungehört: Was in der Wechselwirkung von Politik, Wissenschaft und Medien nahezu ausgeschlossen scheint, ist das Eingeständnis der Kontingenz von Entscheidungen. Das folgt aus der Logik dieses Verbundes und lässt sich nicht vermeiden. Gleichwohl konnte man offenbar auch unter dieser Voraussetzung andere Entscheidungen treffen. Gibt es noch andere Länder auf der Welt, in denen die nunmehr anscheinend zu Unrecht der Pandemietreiberei verdächtigten Kinder wie in Deutschland schon in der Grundschule (und sogar auf dem Schulhof) eine Maske tragen mussten? Da waren in Deutschland wohl andere Kriterien (andere Sicherheitsbedürfnisse) für die Entscheidungsfindung maßgebend als das Wohl der Kinder. Die Formel „das ist unstrittig“ ist symptomatisch für eine strukturelle Immunisierung gegen die Unsicherheit von Entscheidungsgrundlagen. Es liegt anscheinend nicht im Kompetenzbereich des Verbunds aus Politik, Wissenschaft und Medien, dies begleitend zu beobachten. Jedenfalls nicht im Kompetenzbereich der Wissenschaften, die derzeit das Sagen haben. Anderer Wissenschaften vielleicht schon.
Die automatische Gesichtserkennung als ver(un)sichernder Faktor in Zeiten einer (Covid-19-)Pandemie
07. April 2021 | Burkhard Demming
Die automatische Gesichtserkennung ist heute ein fester Bestandteil des Alltags und beeinflusst u.a. das Interaktionsverhalten im öffentlichen und privaten Raum. Das Gesicht ist – wie der Fingerabdruck – als biometrisches Merkmal individuell einzigartig und eignet sich damit zur Freischaltung von Smartphones oder PCs, zur Zutrittsberechtigung zu gesicherten Räumen (Büros, Wohnungen, etc.), zur Personenkontrolle an Grenzen, Flughäfen und Bahnhöfen, zur Bestellung und Bezahlung von Waren, zur Identifikation bei Fahndungen, zur Überwachung in Stadien, etc. Die Gesichtserkennung stellt damit eine wesentliche Quelle für die digitale Sammlung personenbezogener Daten dar und in all den vorgenannten Fällen sind es (Privat-)Personen, die es – als freiwillige (Stichwort: Selfie-Kultur) oder unfreiwillige Datenlieferanten – Institutionen ermöglichen, diese Daten zu verwenden.
Als aufstrebende Technologie wird der potentielle Einsatz der automatischen Gesichtserkennung mit erheblichen Unsicherheiten in Verbindung gebracht, zumal sie im gesellschaftlichen Diskurs sehr häufig mit Überwachung assoziiert wird. Entsprechende Gegenreaktionen kommen insbesondere aus der für diese technologische Entwicklung „relevanten sozialen Gruppe“ (Bijker/Pinch (1987) der „Aktivisten“, die auf unterschiedliche Formen der Nicht-Erkennung zurückgreifen. Zu dieser Gruppe gehören neben Demonstrant*innen, die sich einem staatlichen Zugriff erwehren wollen, Designer*innen, die spezielle Accessoires entwickeln und veräußern (u. a. CV Dazzle (2020), Nicole Scheller / IP Privacy (detector.fm 2020)) sowie Künstler*innen, die die Gesichtserkennungsalgorithmen zur Schaffung von Gesichtsmasken als Kunstwerke nutzen, um den Gesichtserkennungssystemen zu entgehen und diese zu kritisieren (u. a. Zach Blas, Sterling Crispin und Adam Harvey (De Vries/Schinkel 2019). Dazu gehören auch Personen aus der Sousveillance-Bewegung, die mittels ihrer Bild- und Videoaufnahmen den Überwachungsprozess umkehren, indem sie u. a. eigene Gesichtsdatenbanken erstellen und hierüber zur Erkennung von rechtswidrig handelnden Polizist*innen beitragen (u. a. Steve Mann 2004). Aber auch Politiker, Informatiker, Mitglieder von NGOs, Journalisten und Autoren fordern ein Verbot der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum (z. B. gesichtserkennung-stoppen.de). Da die Überwachung an sich jedoch nicht eindeutig ist, kann sie nicht zwangsläufig auf den Aspekt der Kontrolle unter Verdacht stehender Personen reduziert werden, sondern kann auch auf ein Beobachten zur Verbesserung der Sicherheit der Beobachteten ausgerichtet sein (z. B. Schwimmer*innen im Meer).
Diese „'Ambivalenz' des Sehens als schützende und zugleich kontrollierende Praxis“ (Rammert 2016: 179) zeigt sich einerseits u.a. darin, dass seitens der politischen Akteure vermehrt automatische Gesichtserkennungssysteme zur Kriminalprävention eingesetzt werden, um den Bürger*innen ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Dieses belegen zum einen die stark wachsende Anzahl von CCTV-Kameras (Closed Circuit Television) nach terroristischen Anschlägen (09/11, Anschläge in London, etc.) (Norris et al. 2004) und zum anderen Kudlacek (2015) mit seiner Studie zur Akzeptanz von Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Hempel und Töpfer (2004) sowie Krempel (2016) weisen jedoch darauf hin, dass Umfrageergebnisse u.a. durch fehlendes Wissen über Funktionen und Praktiken, durch sozioökonomische Faktoren (z. B. Alter, Bildung und politische Einstellung) oder durch die Medienpräsenz nach aktuellen Terroranschlägen oder Verbrechen beeinflusst werden.
Andererseits werden Bürger*innen u.a. dadurch verunsichert, dass eine Transparenz bzgl. dem algorithmischen Ermittlungsprozess (→ „Black-Box“), den daraus resultierenden Ergebnissen (→ zu hohe Fehlerraten bei der Echtzeit-Identifizierung im öffentlichen Bereich) und insbesondere der Datenverwendung[1] fehlt. Datenschutzrechtliche Regelungen (z. B. EU-DSGVO (2016)) und technische Entwicklungen (z. B. Gesichtsverpixelung direkt bei der Aufnahme, abgestufte bzw. verschlüsselte Zugriffsverfahren hinsichtlich Datenansicht und -auswertung) sollen zwar dazu beitragen das Unsicherheitsgefühl abzubauen, dennoch verbleibt eine latente Besorgnis bzgl. der (Video-)Überwachung, die die Bürger*innen unter einen Generalverdacht stellt.
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie sind die Bürger*innen aufgefordert, ihre Gesichter im öffentlichen Raum und in überfüllten Bereichen zu bedecken, um sich selbst und Andere zu schützen. Die Verwendung von Gesichtsmasken ist somit zu einem wichtigen Bestandteil des Alltags geworden. Dabei hat die Verwendung von Gesichtsmasken für die Genauigkeit der automatischen Gesichtserkennung gravierende Folgen, denn mit Mund und Nase werden wesentliche Teile des Gesichts verborgen und zur Identifizierung eines Gesichts stehen nur noch die Regionen um die Augen, die Stirn und die Ohren zur Verfügung, wodurch es zu falschen Bewertungen von Gesichtserkennungsalgorithmen kommt. Dieses Problem entfällt bei der „menschlichen“ Gesichtserkennung, da Gesichtsokklusionen von Menschen relativ leicht ignoriert und bekannte Gesichter unter unterschiedlichen Betrachtungsbedingungen gut und schnell erkannt werden. Zwar hat die Erkennung von Gesichtern mit Okklusionen - neben Gesichtsmasken auch Sonnenbrillen, Schals, Haare, etc. - die Entwicklung der automatischen Gesichtserkennung seit ihren Anfängen herausgefordert und aktuelle Gesichtserkennungssysteme, die seit dem Erfolg von Alex Krizhevsky et al. (2012) bei der ImageNet-Challenge 2012 zunehmend Algorithmen des maschinellen Lernens verwenden, erzielen qualitativ immer bessere Ergebnisse. Jedoch fordert die aktuelle Gesichtsmaskenpflicht die Entwicklung derartiger Systeme weiter heraus, da bereits erstellte interne Datensets teilweise ungültig und bestehende Gesichtserkennungssysteme weniger effizient oder gar funktionsunfähig werden. Als Beleg für die permanente Entwicklungsarbeit seien nachfolgend drei aktuelle Verfahren beispielhaft vorgestellt, die zu einer Lösung dieser Problematik beitragen.
Chowdary et al. (2020) schlagen zur Identifizierung von Personen mit Gesichtsmaske in ihrem Beitrag ein Transfer-Lernmodell vor. Hierbei wird eine Bildvergrößerungstechnik angewendet, um die wenigen noch erhaltenen lokalen Schlüsselpunkte für das Training und Testen des Modells zu berücksichtigen. Da der Maskenbereich bei diesem Matching-Ansatz quasi verworfen wird, bilden die lokalen Schlüsselpunkte die zentrale Grundlage zur Feststellung von Ähnlichkeiten zwischen zwei Bildern.
Ud Din et al. (2020) verfolgen einen 2-phasigen Ansatz zur maskierten Gesichtserkennung, der darin besteht, dass zunächst der ermittelte Maskenbereich aus dem Bild eliminiert wird und anschließend diese Gesichtsregion so synthetisiert wieder aufgebaut wird. dass eine Kohärenz der Gesichtsstruktur gewährleistet wird. Sie setzen zu diesem Zweck ein GAN-basiertes Netzwerk mit zwei Diskriminatoren ein, wobei der eine Diskriminator für das Erlernen der globalen Struktur des Gesichtes und der andere Diskriminator für das Erlernen der fehlenden Gesichtsregion zuständig ist.
Hariri (2020) zufolge ist dieses Wiederherstellungs- bzw. Restaurationsverfahren, wie es Ud Din et al. vorstellen, jedoch sehr rechen- und zeitintensiv, was einen Einsatz im Echtzeitbetrieb nicht zulässt. Daher schlägt er ein Verfahren vor, das die hohe Leistung und starke Robustheit gegenüber gesichtsokklusionsbedingten Veränderungen von Deep Convolutional Neural Network (CNN)-basierten Methoden nutzt und mehrere Prozessschritte umfasst (u.a. Lokalisierung des Maskenbereichs, ggfs. notwendige Gesichtsdrehungen, räumliche Eliminierung des maskierten Gesichtsbereichs aus dem Bild, Extraktion der besten Merkmale aus den nicht abgedeckten Gesichtsbereichen wie Augen- und Stirnregion, Anwendung des Bag-of-Features-Paradigmas, welches räumliche Informationen verwirft und daher konzeptionell und rechnerisch einfacher ist als alternative Methoden (O'Hara und Draper 2011) sowie die Anwendung eines mehrlagigen künstlichen neuronalen Netzes (Multi-Layer Perceptrons (MLP)) für den Klassifizierungsprozess).
Dass die Covid-19-Pandemie nicht nur Einfluss auf die Entwicklung, sondern auch auf die Qualitätsprüfung von Gesichtserkennungssystemen hat, bestätigt u.a. das National Institut for Standards and Technolgy (NIST), das sich fortlaufend im Rahmen seines Face Recognition Vendor Tests (FRVT) mit der Vergleichbarkeit dieser Systeme befasst. Ngan et al. (2020) haben in ihrer neuesten Ausschreibung die Kriterien hinsichtlich der Genauigkeitsprüfung bei Gesichtserkennungssystemen um die explizite Berücksichtigung maskierter Gesichter erweitert.
Für die Anbieter von Gesichtserkennungssystemen ergibt sich mit Gesichtsmaskenerkennungssystemen, die prüfen, ob eine Person eine Maske trägt oder nicht (Yan 2020), ein neues Geschäftsmodell. So kann die Funktionalität beispielsweise dort angewendet werden, wo das Tragen einer Maske vorgeschrieben ist und bei Verstößen vorab festgelegte Aktionen auslösen, z. B. die Verhinderung des „rechtswidrigen“ Zutritts in einen Geschäftsraum. Derartige Systeme werden von mehreren Herstellern (u.a. eKiosk GmbH, SIB GmbH) u. a. in Kombination mit einem Ampelsystem, basierend auf einer mengengesteuerten und maskenkonformen Zugangskontrolle, angeboten. Die Funktionalität der Gesichtsmaskenerkennung kann in Verbindung mit einer Gesichtsbilddatenbank auch dazu beitragen, dass unternehmensspezifische Richtlinien zum Tragen von Masken eingehalten werden, was neue Datenschutzregelungen erfordert. In CCTV-Kameras integrierte Systeme können das Tragen einer Maske bei den abgelichteten Personen in Echtzeit überprüfen[2].
In vielen ostasiatischen Staaten ist das Tragen von Schutzmasken bereits heute eine Selbstverständlichkeit und auch in der restlichen Welt werden viele Menschen auch zukünftig Masken tragen, um sich vor der Übertragung von Krankheitserregern zu schützen. Daher bleiben die aktuellen Studien zur maskierten Gesichtserkennung nicht nur für die Zeit der aktuellen Covid-19-Pandemie relevant.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die automatisierte Gesichtserkennung – nicht nur als Teil der (Video-)Überwachung im öffentlichen Raum – einen weiter zunehmenden Einfluss auf unseren Alltag haben wird. Es wird sich zukünftig zeigen, ob Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie mit der Erfordernis verbesserter Algorithmen und Verfahren zur Überwindung von Okklusionen durch Gesichtsmasken eher dazu beitragen werden, das Vertrauen in die automatische Gesichtserkennung zu fördern oder aber bestehende Unsicherheiten verstärken.
[1] Benrath (2007) stellt hierzu in seiner Zusammenfassung ergänzend fest: „Hier spielt der Computer eine entscheidende Rolle, indem er die alten Überwachungstechniken des Aufzeichnens und Verbreitens von Informationen durch die Möglichkeit des automatischen Entscheidens ergänzt. Aus „Überwachen und Strafen“ wird damit „Überwachen und Sortieren“, aus individuellen Bewertungen wird massenhafte digitale Diskriminierung auf der Basis von vernetzten Datenbanken und in Algorithmen gegossenen Vorurteilen.“
[2] Zur Überprüfung der Einhaltung des Maskengebots werden solche Systeme i.d.R. in einem verborgenen Modus („Stealth Modus“) z.B. in folgenden Umfeldern betrieben: öffentlicher Raum (Bürger), Unternehmen (Mitarbeiter), Geschäfte (Kunden), Lehreinrichtungen (Schüler u.a.)
Literaturangaben:
Benrath, Ralf (2007). Der gläserne Bürger und der vorsorgliche Staat: zum Verhältnis von Überwachung und Sicherheit in der Informationsgesellschaft. In: kommunikation@gesellschaft, Jg. 8, Beitrag 7, S. 1-16. Hamburg: Hamburg University Press. Im Internet zuletzt abgerufen am 10.3.2021. Zum Artikel
Chowdary, G. Jignesh / Narinder Singh Punn / Sanjay Kumar Sonbhadra / Sonali Agarwal (2020): Face Mask Detection using Transfer Learning of Inception V3, im Internet verfügbar bei arXiv:2009.08369v2
CV Dazzle (2020): Camouflage from Face Detection. Im Internet zuletzt abgerufen am 24.02.2021. Zum Artikel
detektor_fm (2019): IP-Privacy: Mode gegen Videoüberwachung - Kleidung, die unsichtbar macht. Im Internet zuletzt abgerufen am 24.2.2021. Zum Artikel
De Vries, Patricia / Willem Schinkel (2019): Algorithmic anxiety: Mask and camouflage. In: Big Data & Society, Januar–Juni 2019, S. 1-12. Los Angeles: SAGE Verlag
EU-DSGVO (2016): Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). Im Internet zuletzt abgerufen am 2.3.2021. Zum Artikel
Hariri, Walid (2020): Efficient Masked Face Recognition Method During the COVID-19 Pandemic - Preprint – Im Internet zuletzt abgerufen am 4.1.2021. Zum Artikel
Hempel, Leon / Eric Töpfer (2004): Urbaneye: CCTV in Europe. Final Report. Berlin: Centre for Technology and Society – Technische Universität Berlin.
Krempel, Erik Ludwig (2016): Steigerung der Akzeptanz von intelligenter Videoüberwachung in öffentlichen Räumen. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Scientific Publishing
Krizhevsky, Alex / Ilya Sutskever / Geoffrey E. Hinton (2012): ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. In Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems 25, S. 1090-1098.
Kudlacek, Dominic (2015): Akzeptanz von Videoüberwachung. Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung technischer Sicherheitsmaßnahmen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Mann, Steve (2004): Sousveillance - Inverse Surveillance in Multimedia Imaging. ACM Multimedia ’04. New York, USA
Ngan, Mei / Patrick Grother / Kayee Hanaoka (2020): Ongoing Face Recognition Vendor Test (FRVT) - Part 6B: Face recognition accuracy with face masks using post-COVID-19 algorithms. Im Internet zuletzt abgerufen am 10.1.2021. Zum Artikel
Norris, Clive / Mike McCahill / David Wood (2004): The Growth of CCTV. In: Surveillance & Society, Vol. 2004 - 2 (2/3)
O'Hara, Stephen / Bruce A. Draper (2011): Introduction to the Bag of Features Paradigm for Image Classification and Retrieval. Im Internet zuletzt abgerufen am 12.11.2020. Zum Artikel
Rammert, Werner (2016): Technik - Handeln - Wissen. Zu einer pragmatistischen Technik- und Sozialtheorie. 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
Ud Din, Nizam / Kamran Javed / Seho Bae / Juneho Yi (2020): A Novel GAN-Based Network for Unmasking of Masked Face. In IEEE Access Vol. 8 (2020)
Yan, Wudan (2020): Face-mask recognition has arrived - for better or worse. In: National Geographic Online 2020 09, im Internet zuletzt abgerufen am 28.12.2020. Zum Artikel
Seuchen als Krisenverstärker
19. Februar 2021 | PD Dr. Eva-Maria Butz / Gerd Dapprich
Die Corona-Pandemie ist eine Krise, die Mediziner und Politiker zum Handeln zwingt, aber auch Vertreterinnen und Vertreter andere Disziplinen zumindest zu einer Einordnung auffordert. Dabei fällt auf, dass nicht nur Historikerinnen und Historiker den Blick zurückrichten auf mehr oder minder vergleichbare epidemische Ereignisse: Wie gingen frühere Gesellschaften mit ähnlichen Bedrohungslagen um? Wie ordneten und bewerteten sie anhand ihres medizinischen Wissensstandes das Geschehen ein? Welche Handlungsstrategien waren schließlich möglich und gesellschaftlich durchsetzbar?
Die aktuelle Pandemielage führt uns die Bruchstellen unserer Gesellschaft vor Augen. Soziale, gesundheits- und bildungspolitische Schieflagen sind deutlicher als je zuvor sichtbar. Zudem sind die individuellen Folgen noch schwer abzuschätzen. So empfinden nicht wenige die staatlichen Eingriffe in die persönliche Freiheit, die eine abstrakte Bereitschaft zur Solidarität zum Ziel hat, als so massiv, dass sie sich unabhängig ihres Bildungsstandes Gruppierungen und Theorien anschließen, die ohne Corona vermutlich nicht eine solche Zahl an Sympathisanten verzeichnen könnten. Ähnliche Phänomene sind auch in der Vergangenheit zu finden und können durchaus als Seismograph der in Gesellschaften aufbrechenden Konflikte verstanden werden. Seuchen haben immer wieder, so zeigen es zahlreiche Beispiele, als Verstärker bereits vorhandener gesellschaftlicher Verwerfungen gewirkt. So provozieren epidemische und pandemische Krisen auf der einen Seite die Notwendigkeit von herrschaftlichen Handlungskonzepten, auf der anderen Seite Erklärungs- und Handlungsmuster, die gesellschaftliche Konfliktfelder anheizen.
Die erste schriftlich dokumentierte Seuche wütete während des Peloponnesischen Krieges (431 bis 404 v. Chr.) zwischen Athen und dem Attischen Seebund auf der einen Seite und Sparta und dem Peloponnesischen Bund auf der anderen. Sie tötete 30 bis 40 Prozent der 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner Athens. Die Ansteckungs- und Sterblichkeitsrate ist durchaus mit der Pest vergleichbar, auch wenn es sich höchstwahrscheinlich um eine andere Infektionskrankheit handelte. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht: Den Feinden aus Sparta wurde vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben.
Aber auch der politischen Führung, insbesondere Perikles, wurden bei der Bewältigung der Krise schwere Versäumnisse vorgeworfen. Nachdem Perikles seines Amtes als Stratege enthoben worden war, lässt sich der Niedergang des stolzen Stadtstaats sowohl auf der Ebene der demokratischen Staatsform wie auch in der attischen Kunst und Kultur fassen. Gesetze und religiöse Rituale wurden missachtet, der Seebund aufgelöst. Nach Perikles‘ Tod 429 v. Chr. kam es zu einem Aufstand und einem Umsturz, Oligarchen übernahmen die Herrschaft. Dies war zwar ein längerer Prozess, der aber nicht unerheblich durch die Folgen der Seuche befördert wurde. Schon vor dem Tod von Perikles hat es Gruppierungen gegeben, die eine Veränderung des gesellschaftlichen Systems anstrebten. Aber mit der sich ausbreitenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung beschleunigte sich dieser Prozess.
In gewisser Weise – aber bei weitem nicht so, wie angesichts der Coronakrise heute oft vermutet wird – verstärkte auch 1918 die Spanische Grippe längerfristige Entwicklungen. In Deutschland hatte sie allerdings nur sehr geringen Einfluss auf den negativen Verlauf des Ersten Weltkriegs, die November-Revolution und das Ende des Kaiserreichs. Die Deutschen betrachteten diese Seuche vielmehr als einen Teil der allgemeinen Verschlechterung der Volksgesundheit, die aber schon ab 1916 wahrgenommen wurde. Sie stellte nur einen Aspekt des Weltkriegsleids dar, das die Kriegsmüdigkeit und die Kritik am Versagen der politischen Führung verstärkte, die gegen die Krankheit nichts unternahm.
Am tiefsten ins kollektive Bewusstsein der europäischen Bevölkerung eingegraben hat sich wohl der „Schwarze Tod“ (1346 bis 1353), die Beulenpest, an der geschätzt 25 Millionen Menschen verstarben. Die Verbreitung der Krankheit wurde v.a. einer ungünstigen Luftzusammensetzung zugeschrieben. Um dieser zu entgehen, vermummten sich die Ärzte. Dies war ebenso ein medizinischer „Zufallstreffer“ wie die Waschungen mit desinfizierendem Essigwasser. Der Mangel an wirksamen Medikamenten und die Unwissenheit um die Übertragungswege führten zu hohen Todeszahlen. Viele Infizierte starben in der Familie – und steckten diese an. Andere warteten von allen verlassen auf den Tod. Situationen, die sich auch in der aktuellen Pandemie wiederholen.
Dass die Quarantäne von mutmaßlich Infizierten hilfreich sein kann, zeigte die Stadt Venedig, die unter Pestverdacht stehenden Händlern und Reisenden strenge Isolation auferlegte. Im 15. Jahrhundert wurden zwei Lazarette auf Inseln in der Lagune eingerichtet, um Kranke und möglicherweise Infizierte zu isolieren. Ankommende Schiffsladungen wurden gelüftet, aber auch ausgeräuchert bzw. mit Essigwasser oder gesalzenem gekochtem Wasser behandelt. Die Dauer der Isolation von 40 Tagen („quaranta giorni“) ist übrigens der Ursprung des Wortes „Quarantäne“.
Während Venedig durch zielgerichtete Maßnahmen gegen mögliche Übertragungswege vorging, versuchten die Menschen nördlich der Alpen mit anderen Maßnahmen mögliche Ursachen des großen Sterbens zu begegnen. Im Zusammenhang mit dem Schwarzen Tod kam es in einigen Regionen Europas, unter anderem in Deutschland, immer wieder zu Judenverfolgungen. Den jüdischen Gemeinden wurde in einigen Städten schon vor den Pestwellen ritueller Kindermord vorgeworfen, nun kam das Motiv der Brunnenvergiftung hinzu. Da viele Christen, vor allem aus der städtischen Oberschicht und Adlige aus den umliegenden Regionen, Schulden bei jüdischen Geldgebern hatten, stellte sich kaum jemand gegen den wütenden Mob und versuchte die Ermordung und Vertreibung der Juden zu verhindern. Vielmehr wurde das Verhalten im Nachhinein durch den Kaiser, der die jüdischen Menschen im Reich in seinen besonderen Schutz genommen hatte, durch Strafverzicht legalisiert.
Nicht zuletzt wurden Pogrome auch von den sogenannten Flagellanten ausgelöst, deren selbstgeißlerische Bewegung durch die Pest ihren Höhepunkt in Deutschland erreichte, aber von der Kirche abgelehnt wurde. Die Pest wurde als göttliche Strafe verstanden, die nur durch persönliche und gesellschaftliche Reinigung abgemildert werden konnte. In ausgedehnten und blutigen Bußorgien, die als Leiden in der Nachfolge Christi verstanden wurden, zogen diese Gruppierungen von Stadt zu Stadt, und dürften auch damit nicht unerheblich zur Verbreitung der Pest beigetragen haben. Eine andere Hinwendung zur Religion zeigte sich vor allem im 15. Jahrhundert in „Pestblättern“ mit Bildern von Heiligen als Helfer gegen die Pest, höchst ausdrucksstarke Bilder mit Gebetstexten und später auch medizinischen Ratschlägen, die eine Mischung aus Kunst und Religion darstellten. Die Passionsspiele in Oberammergau entstanden 1634 als Reaktion auf die überstandene Pest als ein gesellschaftlicher Erinnerungsort. Für 2020 war übrigens eine Aufführung vorgesehen, die allerdings verschoben wurde.
Eine Folge der Pest war in den betroffenen Landstrichen der weitgehende Zusammenbruch des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Vor allem in der Landwirtschaft fehlten Arbeitskräfte, was die Not vergrößerte. 1349 erließ der englische König das erste Arbeitsgesetz („Ordinance of Labourers“). Menschen konnten zur Arbeit verpflichtet werden, mussten aber denselben Lohn erhalten wie vor der Pest. Handwerker durften keine Wucherpreise mehr fordern. Und die Leibeigenschaft wurde abgeschafft.
England stellt im Vergleich zu Kontinentaleuropa einen Sonderfall dar, denn dort hatte sich schon vor der Pest eine starke Geldwirtschaft im Arbeitsprozess entwickelt. Für die englischen Adeligen wurde die Landwirtschaft bereits im 14. Jahrhundert unrentabel, die Bauern übernahmen sie und erhielten Löhne und mehr Rechte. Damit begann das Zeitalter der Lohnwirtschaft im Mittelalter. Nach einem Bauernaufstand wurde die Leibeigenschaft schließlich durch ein Pachtsystem abgelöst.
Auch auf dem Kontinent änderte sich einiges. Erste Arbeitsgesetze verboten das Wegziehen, erlaubten es andererseits Regionen mit besonders vielen Pestopfern, Arbeitskräfte anzulocken. In den größer werdenden Städten stiegen die Löhne, die Zünfte öffneten sich für mehr Mitglieder und boten Aufstiegschancen. Der Lebensstandard nahm zu, nachgeborene Bauernsöhne und Mittelose konnten sich auf dem entvölkerten Land Bauernhöfe leisten.
Nach dem „Schwarzen Tod“ gab es weitere Pestwellen, die jedoch regional beschränkt werden konnten, z.B. riegelten sich Städte ab, verdächtige Schiffe wurden in Häfen unter Quarantäne gestellt, Erkrankte in abgeschiedenen, oft bewachten Pesthäusern konzentriert. Gegen das bis ins 19. Jahrhundert von Pestwellen heimgesuchte Osmanische Reich bildete Österreich im 18. Jahrhundert auf dem Balkan eine „Pestfront“, ein militärisches Bollwerk. Die Grenzposten, die seit dem 16. Jahrhundert bestanden, wurden zur Seuchenprävention ausgebaut. Ein dezidiertes Quarantänesystem mit genauen Quarantäne- und Desinfektionsvorschriften wurde an den einzelnen Grenzstationen eingerichtet. Händler mussten vor und nach dem Treffen mit dem Handelspartner in Quarantäne. An einigen Stationen wurden die Waren auch kontaktlos auf die andere Grenzseite gebracht. Briefe wurden ausgeräuchert und Münzen in Essig gespült. Letztendlich halfen diese Maßnahmen, Ausbrüche regional einzugrenzen und ein Vordringen nach Westeuropa zu verhindern.
Weitere Veränderungen ergaben sich mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seit dem 18. und 19. Jahrhundert, denen technische Innovationen folgten. Die Naturwissenschaften ermöglichten im späten 19. Jahrhundert die Erkenntnis, dass bei den großen Typhus- und Cholera-Epidemien die Wasserhygiene eine entscheidende Rolle spielte. Trink- und Abwasser wurden nun getrennt und Filtersysteme entwickelt. Als die Cholera 1892 in Hamburg ausbrach, profitierte die Nachbarstadt Altona von einem bereits vorhandenen Sand-Filtersystem, das die Menschen durchaus schützte.
Der Erfolg, eine epidemische Ausbreitung zu verhindern, war und ist sowohl abhängig von medizinischen, technischen und strukturellen Maßnahmen wie auch von der Bereitschaft der Bevölkerung, die als notwendig erachteten Maßnahmen und Einschränkungen mitzutragen. Die große Aufgabe nach der Krise war und ist es, die deutlich gewordenen gesellschaftlichen Probleme zu bewältigen.
Zum Weiterlesen:
Volker Reinhardt: Die Macht der Seuche. Wie die Große Pest die Welt veränderte, München 2. Auflage 2021.
Jens Jacobsen: Schatten des Todes. Die Geschichte der Seuchen, Darmstadt 2012.
Manfred Vasold: Grippe, Pest und Cholera. Eine Geschichte der Seuchen in Europa, Stuttgart 2015.
Masken oder von der Ambivalenz der (Un-)Sicherheit
09. Februar 2021 | Jun.-Prof. Dr. Irina Gradinari
Die Maske, ganz verallgemeinert, war bis vor kurzem vor allem ein künstlerisches Mittel, das aber vorwiegend negativ konnotiert war. Im Film und im Theater benutzen die Schauspieler*innen Make-Up, das dem Gesicht einen stärkeren Ausdruck verleihen sollte, keinesfalls ging es um eine Maskierung des Gesichts. Die Maskennutzung wurde hauptsächlich als anachronistisches Zeichen verstanden, wie z.B. beim Einsatz in der Commedia dell’arte, im japanischen Theater Nō, im Karneval oder als Zeichen der Monstrosität (etwa im Horrorfilm). Auch in der Öffentlichkeit wurde die Verschleierung des Gesichts als negativ angesehen, worüber uns das Vermummungsverbot und auch die Kontroverse über die Burka Aufschluss geben. Die Maske durfte in der Öffentlichkeit bis vor kurzem nicht getragen werden, möglicherweise, weil visuelle Medien jene Aufrichtigkeit und so die ‚Wahrheit‘ (auch als Diskurs) des Gesichtes etabliert haben.
Im Zusammenhang mit der Maske ist in der Genderforschung eine wichtige Theorie der Maskerade zu erwähnen, die die Psychoanalytikerin Joan Reviere in den 1920er Jahre in Bezug auf Weiblichkeit begründet hat. Nach ihrer Analyse einer Patientin kam sie zu dem Schluss, dass Weiblichkeit immer eine Maskerade darstellt, wobei sich hinter der Maske eine weitere Maske verbirgt, jedoch kein substantieller Kern. So wurde die Maskerade zu einer Theorie, die die Position der Frauen als Andere symptomatisch beschrieb. Da die patriarchale Kultur ihnen den Subjektstatus abgesprochen hat, mussten die Frauen Maskerade betreiben, um dem männlichen Subjekt seinen Status zu bewahren, aber durchaus auch, um sich die patriarchale Macht anzueignen. Maskerade identifizierte die Position der Frau, könnte auch subversiv eingesetzt werden und verriet gleichzeitig identitäre Prozessiertheit, die dann gut 80 Jahre später auf Männlichkeiten und dann durch Judith Butler und Marjorie Garber mit dem Phänomen der Travestie grundsätzlich auf alle Subjektivierungsprozesse übertragen wurde. Maskerade war gegen jegliche Essentialisierung der Subjektivierungs- und identitätsstiftenden Prozesse gedacht und wurde daher grundsätzlich als eine subversive Theorie verstanden, die ihre kritische Kraft nicht zuletzt auch aus jener negativen Codierung der Maskerade geschöpft hat.
Jetzt haben wir zunächst eine positive Umcodierung der Maske als Schutz, der mit der Maskenpflicht im öffentlichen Raum gewährleistet werden soll. Die Maske wird so mit der als provisorisch installierten Norm verknüpft. So soll die Maske erhöhte Sicherheit inszenieren, zugleich verweist sie gerade auf das Gefährdetsein der Subjekte und visualisiert letztendlich unsichtbare Gefahren bzw. Viren. Die Maske deutet auf diese Weise auf den Ausnahmezustand hin, in dem nun die Krankheit unter Kontrolle gehalten werden soll, zugleich visualisiert sie aber performativ die sonst verborgene Norm. Wir können die Abweichler*innen, die den Regierungsmaßnahmen nicht folgen, auf den ersten Blick erkennen. Da es in der Regel um eine medizinische Maske geht, ist damit mehr oder weniger eine Art Uniformierung und Entpersonalisierung im Zeichen der Unsicherheit verbunden, die die Bedeutung von Gender, Race und Ethnizität, Religion, aber auch Alter und möglicherweise auch Klasse im öffentlichen Raum außer Kraft setzt. Wir achten auch nicht mehr darauf, ob eine Person eine Burka trägt. So kann man zunächst schlussfolgern, dass die Unsicherheit kulturelle Zeichen mobilisiert. Im Zuge einer solchen Mobilisierung können auch kulturelle Bedeutungssysteme verschoben und transformiert werden. So hat die Unsicherheit die Zuschreibung von intersektionellen Kategorien verändert und die symbolische Kraft einiger der genannten Kategorien gemindert. Die Verbindung mit der Norm verleiht der Maske und auch den Träger*innen eine gewisse Macht – die Maske wird nun zu einer Schaltstelle, an der wir an das Kollektiv, die Norm und so auch an die Macht angeschlossen werden können und aus der heraus wir auch selbst Kontrolle ausüben können. Das ist m.E. eine andere Macht als die, die bei Massendemonstrationen ausgeübt wird (da die Menschen sich aktuell nicht in Massen versammeln dürfen), jedoch wird mit der Maske eine Zugehörigkeit, die normalerweise über Gender, Race oder Ethnizität vollzogen wurde, performativ hergestellt.
In diesem Zusammenhang verändern sich auch Machtverhältnisse im öffentlichen Raum – wir alle wurden von der Regierung beauftragt, die Norm aufrechtzuerhalten, weil es heißt, dass die Maske nicht nur den eigenen Schutz gewährleistet, sondern vor allem ein Schutz für andere sein soll. Jeder muss die Gemeinschaft vor sich selbst schützen – es handelt sich also um einen Appell, sich selbst und die anderen zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang möchte ich den Begriff der delegierten Kontrolle vorschlagen, der aus dem IT-Bereich kommt. „Delegated Administration/delegation of control“ bedeutet die Erteilung der teilweisen oder vollen Administrationsrechte beim Management der Programme oder der Zulassung der anderen Nutzer*innen zu einzelnen virtuellen Bereichen in großen Unternehmen.[1] Das heißt, dass die Maske nun, wie es bei jeder Norm der Fall ist, nicht allein Restriktion und Unterwerfung bedeutet, sondern auch eine gewisse Ermächtigung durch den Anschluss an das Kollektiv.
Für mich ist es insofern ein spannendes Phänomen, als dass es die Kontingenz kultureller Sinngenese und so auch die der intersektionellen Zuschreibungen demonstriert, die nun, wenn auch vorübergehend, keine Rolle spielen. Die Unsicherheit kann somit nicht nur Restriktionen erhöhen, sondern auch bis dahin herrschende Systeme lockern. Daraus wird deutlich, dass die intersektionelle Codierung auch eine visuelle Oberflächenpraxis ist, die nun mit der Maske nicht mehr so gut funktionieren kann. Und wie jedes andere Zeichen kann auch die Bedeutung der Maske nicht von den Regierungsorganen festgelegt oder kontrolliert werden. Die Maske bietet zugleich die sonst ebenfalls nicht erlaubte Anonymität im öffentlichen Raum, aus der heraus durchaus subversive Akte möglich werden.
[1] Mehr dazu vgl. Chubarov, Igor/Gradinari, Irina: Mediale Genealogie der Ansteckung: Syphilis – AIDS – Covid [Медиагенеалогия заражения: сифилис – СПИД – ковид], in: Logos, Jg. 31, Nr. 1 (2021), S. 85-114.
Gastbeitrag: Notizen zu Corona
8. Dezember 2020, 17. Januar 2021 | Prof. Dr. Hans-Heinrich Nolte
Der Tagespresse ist zu entnehmen, dass der Anstieg der mit Corona Infizierten gestoppt wurde und auf einem hohen Niveau verharrt. Christian Nolte hat konkret aus der Charité bestätigt, dass man innerbetrieblich Grenzen der Behandlungsfähigkeit der Klinik nahekommt.1 Das scheint mir einen konkreten und verlässlichen Ausgangspunkt zu bieten. Ich möchte die These vertreten, dass die Protestler – so weit sie nicht über etwas spekulieren, worüber sie, oft nach eigenen Worten, nichts wissen (die Ziele der Regierung oder die von Bill Gates)2 – auch wichtige Argumente in die Debatte einbringen.
Es ist durchaus eine legitime Frage, wie viel Mittel die Gesellschaft ausgeben will, um Coronagefährdete [wie alte Menschen, etwa mich, aber auch junge Leute, welche sich an Vorsichtsmaßnahmen nicht beteiligen wollen] am Leben zu halten. Unsere gegenwärtige Politik geht ja von den Betten für die Pflege aus und rechnet die zurück (die Hoffnung auf die Impfung einmal beiseitegelassen). Da wir nur x Personen mit der schweren Variante von Corona behandeln können, beschließen wir einen Lockdown, um die Ansteckungen herunter zu bekommen, damit nicht mehr als x schwere Fälle entstehen. Wie Christian Nolte gestern bestätigt hat, gerät diese Politik gerade an ihre Grenzen, weil zum Beispiel in Berlin kaum noch Möglichkeiten für Intensivpflege vorhanden sind. In Solingen hat, wie im NRW-TV berichtet wurde, St. Lukas in Solingen sich von der Notfallversorgung abgemeldet, weil besonders viele Ärzte erkrankt sind. Noch können Intensivkranke aber in andere Krankenhäuser gebracht werden.
Christian Nolte ergänzt am 17.01.2021, dass der Anteil der COVID-Patienten auf allen Intensivstationen von Berlin von 34% auf 32% gesunken ist, wozu die hohe Sterblichkeit dieser Patienten beigetragen hat. Das aktuell größte Problem sei, dass alle Betten in den Intensivstationen belegt seien und Notfälle in andere Krankenhäuser, zum Teil nach Brandenburg verlegt werden müssen, was zusätzlich Ressourcen bindet. Trotzdem steht Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern relativ gut da. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtete am 14.01.2021, dass in der Medizinischen Hochschule Hannover Intensivbetten knapp werden, und am 16/17.01., dass der Lockdown keine Wirkung zeigt und die neuen Mutationen eine Verschärfung der Lage befürchten lässt.
Meines Wissens haben wir historisch vergleichbar gehandelt. Bei Seuchen isoliert man seit Jahrtausenden die Erkrankten, schließt die Stadttore und die Ländergrenzen; Leprakranke wurden, wie wir aus der Bibel wissen, isoliert. Die Isolierung der Kranken gelang auch in der Antike nie wirklich, verschaffte aber Zeit. Seuchen konnten sich (ich folge einem Klassiker3) oft dann schnell verbreiten, wenn die Gesellschaften schon in einer Krise waren und Quarantäne-Maßnahmen nicht durchgesetzt werden konnten. Dabei verweist McNeill schon 1977 darauf, dass die zu 100% tödliche Form der Übertragung der Pest die von Mensch zu Mensch war, „as a result of inhaling dropletes carrying bacilli that had been put into circulation by coughing or sneezing …“, wie moderne Ärzte bei einem Ausbruch in der Mandschurei 1921 feststellen konnten.4 Obwohl man vorher diese Infektionsart nicht genau bestimmen konnte, hatte man sie aus Erfahrung mit „verpesteter Luft“ doch umschrieben, und die Pest-Schutzkleidung mit den langen „Schnäbeln“ zum Atmen war sinnvoll.5
Quarantäneregeln, Schutzkleidung, Flucht der Wohlhabenden (Decameron) sind also alte Instrumente der Bekämpfung bzw. des Ausweichens derjenigen, die das können. Auch bei uns stagnieren jetzt die Zahlen der Ansteckungen wenigstens oder gehen vielleicht insgesamt etwas zurück, wie bei manchen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen „Pestumzügen“ – die unterschiedlich Schäden anrichteten, je nach der Reaktion der jeweiligen Stadt oder Landes.
Neu ist meines Wissens, dass unser Staat der Industrie krankheitsbedingte Ausfälle zahlt und Firmen saniert, die von der Seuche betroffen sind. Es ist fast so, als fühle unser Staat sich allzuständig und auch allmächtig. Ähnlich agieren aber viele Regierungen in aller Welt, und sie setzen das als Politik durch. Hat die Politik Erfolge im Sinn des Erfinders? Das werden wir erst wissen, wenn und falls die Ökonomie 2021 wieder anläuft. In China scheint das, aus der Zeitung geschlossen, gelungen. Vielleicht wegen der höheren, auch erzwungenen Sozialdisziplin, vielleicht aber auch, weil der Anteil öffentlichen Eigentums an den Unternehmen dort viel höher ist als bei uns. Ein in öffentlichem Eigentum befindliches Unternehmen kann, wenn die öffentliche Hand diese Entscheidung trifft, eben auch bei Verlusten produzieren, weshalb eine solche Wirtschaftsform von den Liberalen ja auch als „command-economy“ kritisiert wird. Vielleicht hängt die größere Sozialdisziplin aber auch damit zusammen, dass Seuchen im chinesischen Geschichtsbild als regelmäßiges Ereignis berichtet werden,6 und nicht als Himmelsstrafe.
Sollte die Seuche in jenen sozial-liberalen Marktwirtschaften, in denen der Staat einen Teil der ökonomischen Kosten privater Unternehmer wegen der Seuche übernimmt (3. Anleihe an TUI z.B.) nicht bald beendet werden, wird die Frage nach der Bonität selbst für Deutschland gestellt werden.7 Man müsste offen diskutieren, bis zu welchem Ausmaß man die Reproduktion der bestehenden Gesellschaft (Ökonomie, Schule, Familieneinkommen, jetzt in Niedersachsen: Kürzung der Gelder für Wissenschaft) belasten darf/kann, um die gefährdeten Gruppen – grob zusammengefasst uns alte Leute – behandeln und gegebenenfalls am Leben halten zu können. Die Schulden, die zur Zeit aufgehäuft werden, werden die kommenden Generationen bedrücken, wenn sie zurückgezahlt werden sollen (und nicht durch Inflation, Sanierung durch einen „Renten-Euro“ auf Kosten der Hausbesitzer o.ä. minimiert werden8). Die jetzige Schuldenlast rechnet nicht ein, dass eine dritte Welle oder eine neue Seuche kommen kann (vielleicht eine, die mehr Jüngere betrifft, z.B. HIV+x), die bei vergleichbarer Politik noch einmal Summen erfordert, die dann vielleicht nicht mehr finanziert werden können. Beim großen Pestumlauf ist ein Drittel oder ein Viertel der gesamten Bevölkerung gestorben, und manche Dörfer sind „aus“gestorben. Verluste dieser Größenordnung kann selbst der moderne Steuerstaat nicht mehr ausgleichen.
1997 hatte ich die Möglichkeit, in einer Veranstaltung für Vaclav Havel in Prag den amerikanischen Nobelpreisträger Joshua Lederberg zu hören. Er hat damals ausgeführt, dass aus mehreren Gründen (mir als Laien ist vor allem die Vermehrung und Beschleunigung des Luftverkehrs im Gedächtnis geblieben) das kommende Jahrhundert viele neue Seuchen erleben würde, die sich schnell ausbreiten. Die Prognose scheint mir bestätigt zu sein. Ebola ist eingegrenzt worden, Covid 19 nicht. Dass Covid 19 die letzte globale Seuche war, scheint nicht wahrscheinlich; es ist also angemessen, dass die Gesellschaften und Regierungen sich auf ähnliche Attacken vorbereiten. Versucht man, den Vorgang mit dem zugegeben alten Begriffspaar Natur : Kultur zu begreifen, dann ist – aus einer Perspektive aus der „Natur“ – ja auch nicht einzusehen, warum Viren, Bazillen, Pilze oder wer sonst plötzlich aufhören sollten, sich zu entwickeln und zu verbreiten, nur weil wir Menschen den Sieg der „Kultur“ , das „Anthropozän“, verkündet haben.
Das nüchtern zu diskutieren, wäre wichtig, sogar zentral, aber leider entziehen sich viele dieser Ernüchterung (vgl. Max Weber) – die Regierungen, so weit sie tatsächlich glauben, alles im Griff zu haben und alle Ressourcen auf eine Karte setzen (Angela Merkel ist ja wirklich gescheit und betont immer wieder die Verantwortung der Einzelnen, handelt aber jetzt nach dem Guderian-Motto – nicht Kleckern, sondern Klotzen9); die Protestler, indem sie an eine derart allmächtige Regierung (bzw. Kapitalgruppen) glauben, also den Anschein glauben, den einige Politiker und auch einige Weltwohltäter selbst erzeugen. Bei Katastrophen bedeutet ein Glaube an die Allmacht von irgendwem, dass dieser wirklich böse sein muss, da er ja als allmächtig verstanden wird. Das erinnert mich als (wenn auch skeptischen) Bibelleser an die Dichotomie guter : schlechter Engel, oder eben jenen Lichtbringer Lucifer, der Fürst der Finsternis wurde. Die Realität ist ja meist eher das „muddle through“ zu deutsch Durchwursteln. Vornehmer gesagt der Pragmatismus.
Es gibt, um das festzuhalten, zwar historische Argumente und denkbare Parallelen, auch institutionelle Vorgaben für Politik gegen die Seuche, aber es gibt keine von empirischen Wissenschaften erarbeitete Gesamtlösung für eine solche Politik.10 Es kann sie nicht geben, da Covid 19 neu ist; „wir“ erforschen sie erst seit mehreren Monaten. Selbstverständlich kann man der Regierung in diesem Fall nicht vorwerfen, unwissenschaftlich gehandelt zu haben, da es noch gar keinen anerkannten Status von umfassendem Wissen in diesem Zusammenhang gibt.
Was kann man als langfristige Folgen vermuten? Es ist meines Erachtens wahrscheinlich, dass der Abstand zwischen dem „obersten einen Prozent“11 der Weltbevölkerung und dem „Rest“, gemessen nach Einkommen und Vermögen, [12] im Kontext der Seuche weiter gesteigert wird13. Auch die These, dass privates Kapital seinen Anteil an der Gesundheitswirtschaft steigert,14 scheint mir gut begründet (obgleich ich das Gegenteil für wünschenswert halte). Die gegenwärtigen Kämpfe der Nationalstaaten bzw. Unionen, möglichst früh und möglichst viel Impfstoffe zu erhalten, spiegeln die Konkurrenzstruktur und die Ergebnisse spiegeln die Hierarchien. Innerhalb dieses globalen Systems scheint China aufzusteigen.
Selbstverständlich ist Gleichheit nicht Gerechtigkeit, wir sind erfreulicherweise alle sehr unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Eltern, erben also auch unterschiedlich (einige Vermögen in Geld etc., andere in Kultur etc., die meisten gar nichts und manche nur den Kummer eines Alkoholikers als Vater o.ä.). Im Sterben sind wir allerdings auch realiter ziemlich gleich, und darum geht es bei der Impfung ja. Große soziale Ungleichheit führt leicht zu politischen Auseinandersetzungen; große Ungleichheit beim Zugang zu Hilfsmitteln gegen das Sterben mit ziemlicher Sicherheit auch. Welche Möglichkeiten realer Politik haben wir, für mehr globale Gleichheit einzutreten?
Zur umfassenden Diskussion gehört natürlich die Frage, wie weit nationale Regierungen auf globale Realitäten überhaupt angemessen reagieren können;15 selbst Unionen wie die EU oder ASEAN sind ja zu klein, wenn das Virus morgens mit dem Flugzeug von Shanghai nach Frankfurt fliegt und abends weiter nach New York. Dass die USA sich den Versuchen entziehen, an globale Institutionen Teile ihrer Souveränität abzutreten, (keine Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, Austritt WHO etc.), erschwert fraglos eine angemessene Politik. Der BREXIT und die starke nationalistischen Oppositionsbewegungen in Frankreich oder Deutschland zeigen auch, dass die USA in ihrem Nationalismus keineswegs allein sind. Es ist demnach zur Zeit nicht absehbar, dass es zu einer globalen Regierung kommt.16
Aber sieht man von der Frage ab, wie der Einzelne an Politik partizipieren kann, sind darüber hinaus die Möglichkeiten Deutschlands, auf die Politik von Weltmächten wie USA oder China einzuwirken, sehr begrenzt. Das ist theoretisch, vom Konzept der Demokratie aus gesehen, kein Grund zum Protest, da Deutschland nur knapp 1% der Weltbevölkerung hat und ein globaler Konsens ja mindestens über die Hälfte der Weltbevölkerung hinter sich bringen müsste. Der Weg, Nationalstaaten in Unionen zusammen zu fassen, sollte also weiter gegangen und ausgebaut werden.
Theoretisch gesehen ist es allerdings ein Grund zum Protest, dass keine Möglichkeit besteht, zu einem globalen Konsens über eine Politik zu gelangen, mit der man einer ohne Zweifel globalen Bedrohung begegnen kann.
Damit bin ich wieder bei Max Weber und hier dem Bohren dicker Bretter.
1 Prof. Dr. Christian Nolte arbeitet auf der neurochirurgischen Abteilung der Charité. Seine Mitteilung vom 01.12.2020: Momentan ist 1 von 10 Abstrichen bei Mitarbeitern positiv auf CoV SARS 2. Die Zahl der Patienten mit intensivmedizinischer Behandlung ist deutlich gestiegen [aus der hier nicht abgebildeten Tabelle übernommen: von um 20 am 1. September auf um 300 am 1. Dezember]. Momentan ist ca jedes 4. Bett auf einer Intensivstation von einem COVID Patienten belegt. Die Neurologie hat jedes 5. ihrer Betten und Personal an die COVID-Stationen „abgetreten“. Da wir normaler Weise eine sehr gute „Auslastung“ der Betten haben, „fehlen“ diese 20% Betten in der Versorgung der neurologischen Patienten. Der „Bedarf“ an Betten (also stationär behandelten) Patienten mit neurologischen Erkrankungen ist nicht gesunken. Der Krankenstand beim ärztlichen Personal (der Neurologie) lag letzte Woche noch bei 5/30 Assistenzärzten (17%, also Mitarbeiter, die aufgrund von Symptomen in Isolation sind). Das Problem besteht darin, den 24h/7 Tage Dienstplan aufrecht zu erhalten. Die Hygienevorschriften machen die Versorgung zusätzlich anspruchsvoller (Abstrich nehmen, Befund sichten, Patienten bis zum Ergebnis isolieren – dadurch können weitere Betten in dem Zimmer nicht belegt werden …). Verglichen mit dem Frühjahr gibt es aktuell eine höhere Sterblichkeit der Covid-19-Patienten zu verzeichnen. Die naheliegende Erklärung ist der höhere Schweregrad der Erkrankungen (deutlich höherer Beatmungs- und ECMO-Anteil).
2 Als Historiker lernt man ziemlich am Anfang, dass man mit der Frage cui bono nur selten die Intentionen des Akteurs herausbekommt. Einen sehr deutlichen Vorteil aus der Seuche ziehen ja die Krankenversicherungen, aber dass sie die Seuche in die Welt gesetzt haben, bleibt wenig wahrscheinlich.
3 William H. McNeill: Plagues and Peoples (1977) Neuauflage New York 1989 (Anchor-Books), neu rezensiert H.-H.Nolte in Welt-Trends Nr. 171 (Januar 2021) S. 66-68.
4 McNeill a.a.O. S. 147.
5 Bilder in Mary Dobson: Seuchen (2007), deutsch Hamburg 2009, S. 16.
6 Ssu-ma Kuang fasste während der Sung-Dynastie frühere Listen von Seuchen zusammen. Die Listen wurden fortgeführt und reichten 1940 von 243 v. u. Z. bis 1911, Annex zu McNeill a.a.O. S. 259-269.
7 Nach HAZ 15.I.2021 ist die deutsche Wirtschaftsleistung 2020 um 5% geschrumpft. Auch die wirtschaftliche und davon abhängig die fiskalische Hoffnung beruht also auf der Annahme, dass die Seuche 2021 eingedämmt wird.
8 Mein Bezug ist hier die Beendigung der Nachkriegs-Inflation in Deutschland durch Einführung der Rentenmark 1923: 1 Billion Mark = 1 Rentenmark [daneben 1924 „Reichsmark“]. Die Rentenmark war nicht durch Gold, sondern Besitz von Bürgern „gedeckt“.
9 Erfahrungsgemäß ist diese Politik am Ende, wenn nichts mehr da ist, mit dem man Klotzen kann.
10 Man kann ergänzen, dass das eine allgemeine Definition politischer Entscheidungen ist, da Situationen sich nie genau wiederholen. Das ist aber hier nicht die Frage.
11 Das oberste % der Welteinkommenspyramide, gemessen nach Haushalten ca. 80 Millionen Menschen, verfügte 2010 über 15,7% des Welt-Einkommens und 46% des Weltvermögens: Branko Milanović: Die ungleiche Welt, deutsch Berlin 2016 (Suhrkamp) S. 49, 46.
12 Zwischen 1980 und 2016 hatten die untersten 50% der Weltbevölkerung 14% Anteil am Gesamtzuwachs an Einkommen, das oberste 1% 23%: Facundo Alvaredo u.a.: Die weltweite Ungleichheit, deutsch München 2018 (Beck) S. 78.
13 Nach Meinung von Gilbert Achcar: Der Globale Süden und der große Lockdown, in Le Monde diplomatique November 2020, S. 1 & 14 wird sich die Coronapolitik zuungunsten Südostasiens und Afrikas auswirken.
14 Andrea Komlosy, Hannes Hofbauer: Neues Akkumulationsmodell. Verhalten und Körper im Visier des Kapitals, in: Hannes Hofbauer, Stefan Kraft Hg.: Lockdown, Wien 2020 (Promedia) S.79-90.
15 Auch wenn es etwas Rechthaberei ist: Ich habe 1982 zum ersten Mal öffentlich für eine, selbstverständlich föderal gedachte Weltregierung plädiert, vgl. zuletzt H.-H. Nolte: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien 2009 (Boehlau) S. 383-398.
16 Zur Selbstkritik muss ich hier anfügen, dass ich aus Mangel an akademischer Vorbereitung und vorweg gehender Diskussion, also wegen Fehlern im Verständnis des Wesentlichen und in der Diskursivität, die Chance zu einem klareren Statement, die mir ein Hildesheimer Kollege gegeben hat, nicht gut genutzt habe, vgl. die Beiträge zu Michael Gehler, Silvio Vietta, Sanne Ziethen Hg.: Dimensionen und Perspektiven einer Weltgesellschaft, Wien 2018 (Böhlau).
Über die Beherrschbarkeit von Epidemien – ein Vergleich
05. November | Ute Kemmerling
Wäre dieser Artikel vor einem Jahr erschienen, hätte er wahrscheinlich damit begonnen, die bahnbrechenden Entwicklungen in der Medizin im 20. und 21. Jahrhundert hervorzuheben, die Krankheiten und Epidemien immer öfter beherrschbar machen. Doch seit Dezember 2019 zeigt sich ein Virus mit dem Namen Sars-CoV-2 mit neuer Aggressivität, der anfänglich in China auftrat und in kürzester Zeit eine Pandemie ausgelöst hat. Aktuell erleben wir hier in Deutschland die „zweite Welle“, während in Ländern wie den USA bereits von der „dritten Welle“ die Rede ist. Unsicherheit in Bezug auf den noch erst in den Anfängen erforschten Virus äußern sich mannigfaltig in der Gesellschaft, von einer wochen- und monatelangen Isolation bis zu den uns allen bekannten Verschwörungstheorien. Die Sehnsucht nach einer schnellen Heilung mit neuen Therapiemöglichkeiten, am besten mit einer dauerhaften Impfung gegen das Virus, setzt die Wissenschaft von jeher unter Druck, aktuell aber besonders, da die ganze Welt betroffen ist. Einige Forschungsansätze sind plausibel, andere klingen nur wenig wissenschaftlich, vor allem fehlt es aktuell noch an einer soliden Grundlagenforschung. Es wird fieberhaft nach medizinischen Lösungen gesucht und gleichzeitig versuchen die Staaten ihre wirtschaftlichen Verluste unter Kontrolle zu halten.
Neu ist diese Situation nicht, Epidemien hat es immer gegeben und zuweilen treten offenbar bis heute Krankheiten auf, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch unbekannt oder unentdeckt waren. Ein ähnliches Beispiel wie der Befund des neuartigen Covid-19-Virus findet sich im kolonialen Indien des späten 19. Jahrhunderts. In den Bergen von Assam wird 1869 eine Krankheit „entdeckt“, die zu einer so hohen Todesrate führt, dass sie in den Dörfern bis zu 90 Prozent der Bevölkerung dezimierte. Die indigene Bevölkerung nannte die Krankheit sarkari bimari, die britische Regierungskrankheit. Diese Bezeichnung legt nahe, dass die Krankheit von der indigenen Bevölkerung als eingeschleppt und im Zusammenhang mit der Herrschaftsübernahme der Briten im Jahr 1826 gesehen wurde. Um sich hinsichtlich der Teeproduktion von China unabhängig zu machen, hatte die East India Company in den 1830er Jahren die Etablierung der Teeplantagen in weiten Gebieten Assams forciert, doch erst in den 1860er Jahren zeigten sich gewinnbringende Erträge im Teeanbau. Bereits 1878 wurden 28,5 Millionen Pfund Tee von Assam nach England importiert, 1923 sollten es bereits 237 Millionen Pfund Tee sein, die von 527.000 Arbeitern geerntet wurden. Der zunehmend hohe Bedarf an Arbeitskräften wurde mit der Anwerbung von Kulis aus den anderen Teilen Britisch-Indiens sowie aus Mauritius und Reunion gelöst.
Arbeiter, die fortan auf engsten Raum lebten und die vermehrte Bewegung von Menschen, die aus den infizierten Gebieten Assams in andere Regionen Indiens zurückwanderten, unterstützte eine rapide Verbreitung der Krankheit. Kala-Azar (Hindi für Schwarze Krankheit) war der geläufigere Name für die Infektionskrankheit, die durch Parasiten ausgelöst wird, welche von einer Sandmücke übertragen werden. Der Parasit breitet sich auf die inneren Organe des Menschen aus, vor allem werden Milz, Leber und das Knochenmark befallen. Laut WHO gehört sie bis heute zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten, die besonders die arme Landbevölkerung oder die benachteiligte städtische Bevölkerung trifft. Ohne Behandlung führte die Krankheit im 19. Jahrhundert in der Regel innerhalb weniger Monate zum Tod. Kala-Azar wurde in den ersten Jahrzehnten ihrer Wahrnehmung für eine Form der Malaria gehalten. Sie ist eng mit dem indischen Subkontinent verknüpft, besonders mit den Provinzen Assam und Bengalen, wo ein bedeutender Teil des Wissens über die Krankheit entwickelt wurde. Kala-Azar gehört wie Malaria oder Gelbfieber zu den Tropenkrankheiten, denen besonders viele Menschen zum Opfer fielen, besonders die Teeplantagenarbeiter. Die Epidemien nahmen damit auch maßgeblich Einfluss auf die wirtschaftliche Komponente der Kronkolonie. Die britische Kolonialregierung sah sich durch die hohe Todesrate ihrer Arbeiter ab 1882 veranlasst, geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit Kala-Azar herauszuarbeiten. Die Wissensgenerierung zu Kala-Azar und ihre Therapiemöglichkeiten war somit zu einem wesentlichen Anteil von Eigennutz der britischen Regierung bestimmt, diente sie doch dem Schutz der eigenen zivilen Bevölkerung, der in den Kolonien stationierten Truppen sowie den indigenen Arbeitskräften. In Assam hatte sich die Tee-Industrie zu einem prosperierenden Wirtschaftsmarkt entwickelt, den es zu schützen galt.
Die Tropenmedizin, die sich mit der Erforschung unbekannter Krankheiten in den Kolonien befasste, etablierte sich zunehmend. Wichtigste Voraussetzungen für die Erforschung der Krankheiten waren seit Ende des 19. Jahrhunderts die neuartigen Instrumente und wissenschaftliche Methoden, wie beispielsweise das Mikroskop, Mikrofotografie, Tierversuche und die Datenerfassung, neben dem bedeutsamen fachlichen Erfahrungsaustausch. Die geographische Ausbreitung und die Dauer sowie der Umfang der auftretenden Epidemien wurden genauestens untersucht. Der wissenschaftliche Diskurs zu Kala-Azar beginnt in Indien und zeigt sich dann vor allem in Europa. Verschiedene Fachdisziplinen beteiligen sich: Medizin, Chemie und Pharmakologie. Fehlinterpretationen blieben nicht aus, die von der britischen Regierung angeordneten Untersuchungskommissionen führten vielfach zu keinem oder einem falschen Ergebnis. Erst 34 Jahre nach der Entdeckung der Krankheit fanden die britischen Ärzte William Boog Leishman und Charles Donovan den Krankheitserreger. Ihre Namen haben sich auch in der aktuellen Bezeichnung der Krankheit Leishmania donovani manifestiert. Sie veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse im Jahr 1903 über die wissenschaftliche medizinische Fachzeitschrift British Medical Journal.
Die britische Herangehensweise, die Krankheit Kala-Azar zu erforschen, mit dem Ziel, sie mit moderner europäischer Medizin zu behandeln und schließlich zu heilen, wird als Erfolgsgeschichte konzipiert. Deren wesentliche Momente sind das „Erkennen“ der Krankheit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die „Entdeckung“ der Krankheitsursache, des Parasiten im Jahr 1903 und schließlich die „Entwicklung“ einer wirksamen Behandlung durch die modernen Arzneien im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die Tropenforschung schritt in den folgenden Jahren voran, es wurden kolonialstaatliche Institutionen mit eigenen Abteilungen für die Erforschung von Kala-Azar in Britisch-Indien gegründet – Maßnahmen, an denen man erkennen kann, wie wichtig die Erforschung der Krankheit für die Kolonialmacht war. So forschte die Calcutta School of Tropical Medicine seit 1922 zu Kala-Azar. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte der indische Mediziner Upendranath Brahmachari erstmals ein Medikament gegen die bis dahin meist tödlich verlaufende Krankheit.
In den letzten Jahrzehnten hat sich immer stärker die These durchgesetzt, dass wir bereits seit Jahrhunderten in einer polyzentrischen Wissenswelt leben, die durch „entangled knowledge“, also ineinander verschränkte oder miteinander verflochtene Wissenssysteme charakterisiert ist. Die Betrachtung der epistemischen Maschinerien der Wissenserzeugung zeigt demnach vor allem eins: die Fragmentierung zeitgenössischer Wissensprozesse. Bezogen auf die medizinische Forschung finden sich nach Ludwik Fleck die Entwicklungsanlagen eines Wissens in der Vergangenheit. Diesbezüglich bewiesen Zusammenhänge innerhalb des Wissens eine Wechselwirkung zwischen Erkanntem und dem Erkennen. Die Wechselwirkung zwischen Erkanntem und Erkennen verlange jedoch nach Fleck den Zusatz „‘aufgrund des bestimmten Erkenntnisbestandes‘ […] oder am besten ‚in einem bestimmten Denkstil, in einem bestimmten Denkkollektiv‘“ (Fleck 1980 [1935], 54). Dieser „Erkenntnisbestand“ zeigt sich deutlich in den wissenschaftlichen Untersuchungen zu unbekannten Krankheiten.
Kala-Azar oder die viszerale Leishmaniose, wie die Krankheit ebenfalls genannt wird, stößt in den letzten Jahren auch in Westeuropa wieder auf verstärktes Forschungsinteresse. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Zum einen wird im Zusammenhang mit der Debatte zur Klimaerwärmung argumentiert, denn Kala-Azar, oder besser ihr Vektor, die Sandfliege, erreiche aufgrund der steigenden Temperaturen verstärkt auch Europa. Zum anderen hat die EU Anreize für die Pharmaindustrie und andere Forschungseinrichtungen geschaffen, vermehrt zu seltenen Krankheiten zu forschen. Die Wissenschaftler Ralf Erdmann, Inhaber des Lehrstuhls für Systembiochemie der Ruhr-Universität Bochum, und sein Mitarbeiter Vishal Kalel forschen aktuell zu Trypanosomen (Parasiten). Neben der Malaria oder der Schlafkrankheit experimentieren sie auch zu Leishmaniose und hier insbesondere zu neuen Wirkstoffen. Die vorhandenen Medikamente lösen starke Nebenwirkungen aus und können die Parasiten nicht vollständig vernichten. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums München und der Medizinischen Universität Warschau haben Erdmann und Kalel im Oktober den Erwin-Schrödinger-Preis bekommen.
Die Erkenntnisse, die sich im Verlauf der Erforschung unbekannter Krankheiten wie Kala-Azar ergaben, sind selten das Ergebnis einer einzelnen Arbeit, sondern von jahrzehntelangen schrittweisen Forschungsprozessen im wissenschaftlichen Bereich und vor allem durch interdisziplinären Austausch geprägt. Hier zeigen sich Parallelen zur Erforschung von Covid-19. Weltweit befassen sich unterschiedlichste Forschergruppen mit der Pathologie des Erregers, der tieferen Diagnostik der Erkrankung und den verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Die digitale Vernetzung macht es deutlich einfacher, dass sich die Wissenschaftler*innen intensiv über ihre aktuellen Ergebnisse austauschen können. Es besteht die Hoffnung, dass aus dem Erkannten ein Erkennen resultiert, wie Fleck es formuliert hätte.
Die Erforschung von Covid-19 wird jedoch noch lange nicht abgeschlossen sein. Sie wird nicht über einhundert Jahre dauern, wie bei Kala-Azar, doch der tatsächliche Ursprungsüberträger des Virus gibt den Wissenschaftlern weiterhin Rätsel auf, potentielle Medikamente dürften auch längerfristig erforscht werden und eine Impfung gegen den Virus muss zunächst verschiedene Testreihen durchlaufen, bevor diese überhaupt an Menschen erprobt werden darf. Das globale wissenschaftliche Engagement ist beeindruckend. Wie bei Kala-Azar dient die Erforschung von Covid-19 dem Eindämmen einer Epidemie, die nicht nur unzählige Menschenleben kostet, sondern auch maßgeblich die Wirtschaft beeinträchtigt. So ist und war die Erforschung von Epidemien immer untrennbar mit den verschiedenen Interessen in Politik und Wirtschaft verbunden. Aber – und hier zeigt sich ein großer Unterschied zu dem Umgang mit Kala-Azar oder auch anderen Epidemien, die bis jetzt in der Regel die ärmeren Länder der Welt betrafen – auch die Industriestaaten sind von Covid-19 betroffen. Diese Epidemie oder besser Pandemie zeigt eine neue Dimension und stellt möglicherweise eine Zäsur dar, welche die Gesellschaften dauerhaft zum Umdenken zwingt. Die Unsichtbarkeit des Virus macht jeden Bürger zum potentiellen Virusträger, ein Hauptgrund für die Verunsicherung allerorts. Es wirft die brisante Frage auf, ob die Forschung nach einem Medikament oder Impfstoff so drängend forciert würde, wenn nicht auch die reichen Industriestaaten so massiv und unterschiedslos betroffen wären. Zudem bleibt offen, ob es im nächsten Jahr eine faire Verteilung des Impfstoffes geben wird, oder ob sich ein „Impfstoff-Nationalismus“ offenbart, wie beispielsweise die Washington Post jüngst vermutete.
Verwendete Literatur
Donovan, Charles 1903: On the Possibility of the Occurrence of Trypanosomiasis in India in: The British Medical Journal, Vol. 2, London, S. 79 und Leishman, William 1903: On the Possibility of the Occurrence of Trypanosomiasis in India in: The British Medical Journal, Vol. 2, London, S. 1376-1377.
Dutta, Achintya Kumar 2005: Kala-Azar in Assam. British Medical Intervention and People’s Response, in: Bagchi, Amiya Kumar; Soman, Krishna (Hg.): Maladies, Preventies and Curatives. Debates in Public Health in India, New Delhi, S. 15-31.
Fischer-Tiné, Harald 2013: Pidgin-Knowledge. Wissen und Kolonialismus, Zürich-Berlin.
Fleck, Ludwik 1980 [1935]: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Frankfurt a. M., S. 54.
Gaint, Edward 1933: A History of Assam, Calcutta.
Merdes, Dominik 2019: Die Produktion eines Pharmakons. Eine Kartographie der Kala-Azar und der Antimonalien, Stuttgart.
Fußnote zur Risikobewertung
04. November 2020 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Hier – da sich jetzt alle Gedanken darüber machen, ob die Maßnahmen des neuen, zeitlich befristeten ‚Lockdown‘ zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens ‚wirklich greifen‘ werden – eine kleine Fußnote zur Risikobewertung. In einer Stellungnahme, von der ZEIT-online am 9. Oktober 2020 berichtet, erklärte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, das „Säubern von Oberflächen im Kampf gegen die Corona-Pandemie als überflüssig und überholt“. Inzwischen wisse man doch, dass die Ansteckung „ausschließlich über den Luftweg“ stattfinde und „nicht über Schmierinfektionen“. Die „Desinfektion von Oberflächen“ sei „unsinnig und obsolet“. Das Robert-Koch-Institut solle das gefälligst „zum Erkenntnisstand erheben und den Gesundheitsämtern mitteilen“, damit die gewonnenen Ressourcen für eine sinnvolle Bekämpfung des Corona-Virus freiwerden. Schließlich werden Millionen und Abermillionen Arbeitsstunden und Milliardenbeträge in Hygienekonzepte gesteckt, in denen die Sicherung vor möglichen Schmierinfektionen noch immer ein zentraler Aspekt ist. Das war eine klare Ansage, die aber mehr oder weniger ungehört verhallte. Die sogenannten AHA-Regeln sind noch immer in Kraft und spiegeln vor, die Hygiene sei neben dem Abstandhalten und der Atemschutzmaske ein gleichberechtigter Faktor. Das ist nicht verwunderlich. Mit kaum etwas tun sich die Untertanen und die Obrigkeit schwerer als mit der Rücknahme von Warnungen im Allgemeinen und hygienischen Vorsichtsmaßnahmen im Besonderen. Eine umfassende Theorie der Warnung müsste klären, was es mit der Asymmetrie von Warnung und Entwarnung auf sich hat. In diesem Falle gilt jedenfalls: Mit der Entwarnung würde man ‚ein falsches Signal setzen‘. Und außerdem: Man weiß ja nie. Kann man denn ausschließen, dass sich nicht doch jemand auf diesem Wege ansteckt? Mit einer vernünftigen Risikobewertung ist es bei den Menschen nicht weit her.
Es gibt, was viele nicht wissen, ein Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Es wurde, wie im Internetauftritt nachzulesen, im Jahre 2002 geschaffen, „um den gesundheitlichen Verbraucherschutz zu stärken“. Dazu gehören vor allem „Fragen der Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie zur Sicherheit von Chemikalien und Produkten“. Organisatorisch ist das Institut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zugeordnet. Mit der Corona-Pandemie hat das freilich nur indirekt etwas zu tun, aber da „Risiken erkennen - Gesundheit schützen“ das Motto dieses Instituts ist, und da Viren bekanntlich überall sein können, hat das Institut auch hierzu Informationen bereitgestellt und FAQ beantwortet. Und da kann man nun als Antwort auf die Frage „Kann man sich über Lebensmittel oder Gegenstände mit Coronaviren anstecken?“ lesen: „Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen, wodurch nachfolgend Infektionen beim Menschen aufgetreten wären, gibt es derzeit keine belastbaren Belege.“ Eine neue Erkenntnis ist das nicht. Denn bereits in einer Stellungnahme vom 29. Januar erklärte das Bundesinstitut für Risikobewertung zu den Übertragungswegen beim „neuartige[n] Coronavirus“: „Die Übertragung bereits bekannter Coronaviren auf den Menschen geschieht in der Regel über die Luft als Tröpfcheninfektion. Dafür ist enger Kontakt mit einem den Virus tragenden Tier oder einem infizierten Menschen nötig. Für die Möglichkeit einer Infektion des Menschen über den Kontakt mit Produkten, Bedarfsgegenständen oder durch Lebensmittel gibt es, auch beim aktuellen Ausbruch, bisher nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand keine Belege.“
Folglich ist das Risiko, sich über Schmierinfektionen mit dem Virus zu infizieren, nicht zu berechnen, da der Fall noch nicht nachgewiesen werden konnte. Und das war anscheinend auch, da es sich auch bei den anderen Corona-Viren so verhält, nicht anders zu erwarten. Umgangssprachlich sagt man dazu, dass das Risiko ‚gleich Null‘ ist. Das ist natürlich nicht korrekt. Es ist nur ‚verschwindend gering‘. Daher fügt das Bundesinstitut für Risikobewertung zwar nicht in weiser Voraussicht, aber immerhin vorsichtshalber hinzu: „Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden.“¹ Natürlich: Der Fall kann eintreten. Man kann auch, wenn man eine Straße entlangläuft, von einem herunterfallenden Gegenstand erschlagen werden. Derlei ist schon vorgekommen (zumindest in Filmen). Aber deswegen werden wir ja nicht verpflichtet, auf allen unseren Fußwegen durch die Stadt einen Schutzhelm zu tragen. Im Gegenteil: Wer unter Hinweis auf diese Möglichkeit stets mit Schutzhelm durch die Straßen liefe, dessen psychische Gesundheit würde man ernstlich in Zweifel ziehen.
Ganz anders beim Virus. Das sieht man eindrucksvoll an einer Statistik, die ebenfalls vom Bundesinstitut für Risikobewertung stammt. Denn interessanterweise hat sich das Institut in dieser Sache nicht nur mit der eigenen Risikobewertung beschäftigt, sondern auch mit der Einschätzung des Risikos durch die Bürgerinnen und Bürger. Seit Ende März hat man in einer wöchentlichen Befragung im sogenannten „Corona-Monitor“ herauszubekommen versucht, wie die Bevölkerung bei verschiedenen Ansteckungsmöglichkeiten das jeweilige Risiko einschätzt, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Und da kommt es dann an den Tag, dass es mit der Fähigkeit der Deutschen zum Schätzen, in dem sich – siehe mein Blogbeitrag vom 5. Juni 2020 – der aufgeklärte Vernunftgebrauch realisiert, nicht weit her ist. Die Statistik vom 27./28. Oktober zeigt: 47 Prozent der Deutschen halten – nach eigenem Bekenntnis – die Wahrscheinlichkeit, sich über eine Türklinke mit dem „neuartigen Coronavirus“ anzustecken, für hoch oder sehr hoch, obwohl bis jetzt keine einzige Ansteckung über eine Türklinke nachgewiesen worden ist.² Das ist erschütternd.
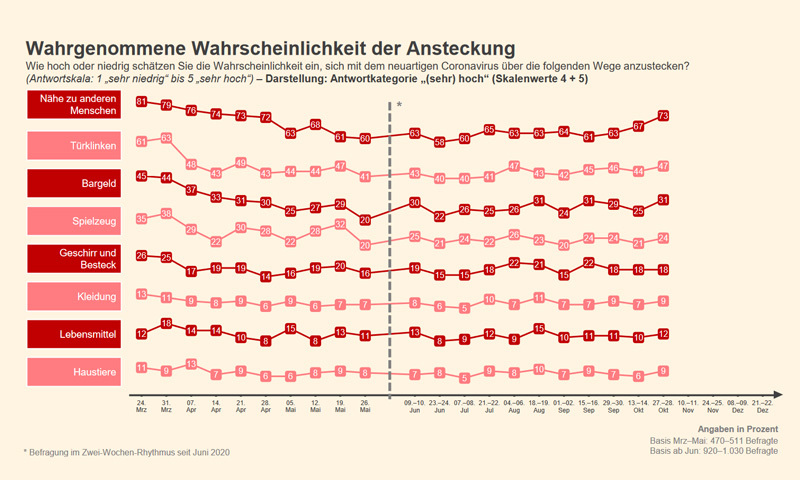 Abbildung: BfR Corona-Monitor | 27.–28. Oktober 2020
Abbildung: BfR Corona-Monitor | 27.–28. Oktober 2020Womit hängt das zusammen? Wenn man die Leute fragt, dann sagen sie eben: Man weiß ja nie. Das heißt: Ein Rest Unsicherheit bleibt doch! Es ist ja nicht ausgeschlossen. Deshalb die Desinfektion: Sicher ist sicher. Das erklärt aber nicht, warum gerade hier auf einem Rest an Unsicherheit nicht nur insistiert wird, sondern dieser auf groteske Weise vergrößert wird. Eine Ursache für die Angst kann freilich sogleich dingfest gemacht werden. Noch bevor sich das neuartige Corona-Virus hierzulande nennenswert verbreitet hatte, machte schon in den Medien und demzufolge unter den Leuten die Runde, wie lange das Virus auf Oberflächen verschiedener Art nachgewiesen werden kann. Zudem weiß man ja, dass andere Infektionskrankheiten sich sehr wohl über Türklinken etc. verbreiten. Jüngst haben australische Forscher herausgefunden, dass das Virus auf glatten Oberflächen bis zu 28 Tage ‚überleben‘ kann. Damit hatten sie einen Rekord aufgestellt, der sogleich in aller Munde war. Da nützt es wenig, dass die Virologen – wie bei den zahllosen Studien zu diesem Thema zuvor – auch hier wieder betonten, das seien Experimente unter Laborbedingungen, also unter kontrollierten Bedingungen, die auf das wirkliche, unkontrollierte Leben nicht übertragbar seien.
Wie etwa die Virologin Stephanie Pfänder von der Ruhr-Universität Bochum erklärt, nimmt die Viruslast auf kontaminierten Oberflächen innerhalb der ersten Stunde bereits stark ab. Um eine Infektion auszulösen, ist eine ziemlich lange Kausalkette erforderlich: Es muss jemand mit hoher Viruslast in seine Hand husten, dann eine Türklinke drücken, dann muss rechtzeitig ein anderer kommen, diese Türklinke anfassen, sich danach möglichst zügig ins Gesicht fassen, und zwar am besten in Mund oder Auge. Auszuschließen ist das nicht. Aber es ist kein Wunder, dass eine solche Verkettung noch nicht nachgewiesen wurde. Dass sich der sogenannten Heinsberg-Studie zufolge mehr als die Hälfte der Personen, die mit einem Infizierten zusammenlebten, selber nicht infiziert haben, obwohl in diesem Fall wohl kontaminierte Oberflächen en masse zur Verfügung standen, spricht ebenfalls dafür, dass das nicht so funktioniert.
Trotzdem hieß es immer wieder in verschiedenen Modulationen: „Ca. 10 Prozent der Corona-Infektionen passieren durch Schmierinfektionen, so schätzt der Berliner Virologe Christian Drosten.“ Das war eine recht frühe Aussage von Christian Drosten. Gemeint war, dass wohl nur 10 Prozent des Infektionsgeschehens auf Schmierinfektionen zurückzuführen seien. Gleichwohl war die Zahl, die als Reaktion auf schon bestehende Ängste aufzufassen ist, schon damals völlig aus der Luft gegriffen. Schon im Juni vertrat Drosten die Ansicht, man solle nicht zu viel Gewicht auf die Desinfektionsmaßnahmen legen. Entwarnung gab er freilich nicht. Sicher ist sicher. Derweil schrieb man in NRW den Gaststätten vor, dass auch die Gewürzspender nach jedem Gästewechsel zu reinigen und zu desinfizieren seien; der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeughandwerks (ZDK) empfahl, bei Autoreparaturen mit Schutzfolien im Cockpit zu arbeiten und alle Flächen in der Fahrgastzelle zu desinfizieren; in den Bibliotheken kamen die zurückgegebenen Bücher erst einmal in Quarantäne oder wurden mitunter gar nicht mehr zurückgenommen. Und Kugelschreiber, mit denen man in der Bank eine Unterschrift leistet, darf man noch heute aus einer frischen Tüte nehmen und später behalten, weil sie möglicherweise kontaminiert sind. Usw. Von einigen dieser Vorkehrungen hat man zwar nach und nach Abstand genommen, aber noch immer geistern die „10 Prozent“ durch die Diskurse, obwohl sich kaum eine vernünftige, geschweige denn wissenschaftliche Begründung für diese Zahl geben lässt, wenn eine Infektion auf diesem Wege bislang nur „nicht ausgeschlossen“ werden kann. Im NDR-Podcast, den Christian Drosten derzeit im Wechsel mit Sandra Ciesek, der Leiterin der Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main, bestreitet, erklärte letztere am 21. Oktober: „Wie groß der Anteil von Schmierinfektion ist, weiß man nicht genau. Ich glaube, man schätzt zehn bis 16 Prozent ungefähr.“ Naturwissenschaft sollte sich anders anhören.
Die Folgen solcher Schätzungen lassen sich an den Umfrageergebnissen des Bundesinstituts für Risikobewertung ablesen. Aber wie gesagt: Erklärt ist damit noch nichts. Denn erklärungsbedürftig ist ja nicht nur die erhobene Risikoeinschätzung der Bevölkerung, sondern auch die von den Naturwissenschaftlern vorgetragene. Um die Ängste zu erklären, die hier walten, braucht es das Wissen und das Denken der Kultur- und Sozialwissenschaften. Dieses Denken ist durchaus da. Man muss nur zugreifen und begreifen, dass man ohne dieses Denken nicht auskommt, wenn man den Kontext der gegenwärtigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Allgemeinen und der Hygienemaßnahmen im Besonderen verstehen und – um im Jargon zu bleiben – diesbezügliche Folgeabschätzungen anstellen möchte. Wie wirkt sich das Ideal der Kontrolle auf das Soziale aus? In welchem Verhältnis steht es zum Phantasma der Reinheit? Welche Eigenlogik entfaltet sich in der Geschichte der Hygiene? Wie ist es um das Verhältnis von Biopolitik und Immunität bestellt? Was sagen die Psychoanalyse und die Ethnologie über magisches Denken und Berührungstabus? Welchen Platz nimmt die Naturwissenschaft in der symbolischen Ordnung ein? Die Fragen ließen sich vermehren.
² BfR Corona-Monitor | 27.–28. Oktober 2020, S. 12 (PDF, 433 KB)
Das Ende der Sommerpause
03. November 2020 | Eryk Noji
Beinahe hätte man denken können, die Situation hätte sich entspannt. Im Zuge des Lockdowns im März und April wurde es wärmer. Man konnte an die frische Luft. Menschen begannen mit der Zeit sich draußen mit anderen zu treffen. Irgendwann folgten Schulen und Geschäfte, die mit Hygienekonzepten wieder öffnen durften. Dann gab es auch wieder gastronomische Angebote, die mit ihren Außenbereichen ebenfalls von dem guten Wetter profitierten. Die Ansteckung mit dem Virus schien im Wesentlichen dort ein Problem zu sein, wo Menschen dem Kontakt in Innenräumen schlecht ausweichen konnten – in Schlachtereien etwa, in Schulen oder Pflegeheimen. Das war unter Kontrolle zu bringen.
Doch dieser Schein erwies sich als trügerisch. Jetzt, da die Temperaturen kälter, das Wetter schlechter und die Innenräume befüllter wurden, sind auch die Ansteckungsraten explosionsartig angestiegen. Die Sommerpause ist gewissermaßen zu Ende. Die 7-Tage-Inzidenz ist in weiten Teilen Deutschlands auf einem Wert weit über 100 und damit deutlich über den Grenzwerten von 25 und 50, die als Alarm für eine regionale Verschärfung von Maßnahmen dienen sollten. Deutschlandweit gab es demnach etwa 120 Infektionen auf 100.000 Einwohner*innen in den letzten sieben Tagen – Stand 02.11.2020. [Situationsbericht, RKI]Dies überfordert die Gesundheitsämter, sodass drei Viertel der Fälle nicht mehr zugeordnet und Kontakte entsprechend nicht mehr nachverfolgt werden können.
Die Reaktion ist ein zweiter Lockdown im November. Die Bekämpfung des Virus geht in eine neue Runde. Das nehmen wir zum Anlass, auch den Blog wieder frequenter mit Beiträgen zu füllen, um interdisziplinär Schlaglichter auf die Pandemie zu werfen. Denn sowohl das Virus selbst als auch die Maßnahmen zu dessen Bekämpfung bringen vielfältige Unsicherheiten hervor, derer wir uns widmen wollen und zu denen die kommenden Beiträge hoffentlich den ein oder anderen interessanten Zugang gewähren.
Vom Schätzen
05. Juni 2020 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Es empfiehlt sich – zumal für diejenigen, die sich hinsichtlich der Pandemie mit dem Aspekt der Unsicherheit beschäftigen – über ein Wort nachzudenken, das oftmals nicht genug geschätzt wird: das Wort schätzen. Hier ein paar Bemerkungen dazu. Zunächst einmal liegt auf der Hand, dass die Tätigkeit des Schätzens etwas mit Unsicherheit im weitesten Sinn zu tun hat und dass sie selbst eine unsichere Sache ist: Wir schätzen eine Entfernung, die wir nicht messen können oder deren Messung zu aufwändig ist. Wir schätzen eine Summe, die wir nicht berechnen können oder deren Berechnung zu viel Zeit kosten würde. Schätzen heißt eben: etwas nur ungefähr angeben und auch nur über ungefähre Kriterien darüber zu verfügen, wie man zu dieser Schätzung kommt. Insofern sieht es zunächst einmal so aus, dass das Schätzen nicht in die Wissenschaft gehört, die nun einmal, wenn sie sich schon nicht zu eindeutigen Angaben und Aussagen aufschwingen kann, wenigstens über eindeutige Kriterien verfügen sollte. Aus der Perspektive der Wissenschaft scheint das Schätzen sozusagen etwas Voreiliges zu sein.
Für uns Menschen ist das Schätzen hingegen eine Schlüsselkompetenz, die nur zu leicht unterschätzt wird. Schätzen will gelernt sein; wer nicht ungefähr abschätzen kann, wie viel Geld er im Monat ausgibt, muss über alle Ausgaben Buch führen, oder er läuft Gefahr, vor der Zeit kein Geld mehr übrig zu haben; wer nicht schätzen kann, wie viel eine Prise Salz ist, wird möglicherweise sein Essen versalzen; wer nicht schätzen kann, wie viel er trinken darf, bevor er über 0,5 Promille ist, bekommt vielleicht den Führerschein weggenommen; wer die Geschwindigkeit eines Autos falsch einschätzt, kommt am Ende unter die Räder. Die Fähigkeit zu schätzen kann mehr oder weniger gut ausgebildet sein, und sie erfordert – immer bezogen auf das in Frage stehende Gebiet – eine ganze Menge an Erfahrungen und Weltwissen, das sich aus sehr verschiedenen Quellen speist. Die Tätigkeit des Schätzens ist für uns Menschen unausweichlich und fundamental (dass das Wort auch im Sinne von wertschätzen verwendet wird, kommt hinzu, kann aber hier beiseite gelassen werden).
Was das mit der Corona-Krise zu tun hat, dürfte klar sein. Im Moment muss viel geschätzt werden. Aber man misstraut dem Schätzen auch. Im Fernsehen wurden wiederholt Gastwirte gezeigt, die die Abstände zwischen den Sitzplätzen vermaßen, weil man sich auf das Schätzen des Sicherheitsabstandes von anderthalb Metern nicht verlassen wollte bzw. durfte. Allein diese sagenhaften anderthalb Meter Abstand wurden in den letzten Monaten allein in Deutschland vermutlich mehrere Milliarden Mal abgeschätzt und Gegenstand millionenfacher Diskussionen. Das ist natürlich nur eine Schätzung. Aber dies ist nur die einfache und harmlose Seite der Sache. Eigentlich geht es natürlich um die Risikoabschätzung. Wie hoch schätzt man ein Risiko ein? Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand ist ja dazu da, um uns des Schätzens zu entheben. In einem früheren Blog habe ich geschrieben: „In uns residiert gewissermaßen ein kleiner Kalkulator, der mutmaßlich verquere Risikoabschätzungen darüber anstellt, ob es zum Beispiel ‚sicher genug‘ ist, dass man sich mal ‚mit Freunden‘ trifft, wenn man ‚aufpasst‘, dass man sich nicht ‚zu nahe‘ kommt usw.“ Das war zumindest missverständlich. Wir kalkulieren eben gerade nicht. Wir können nichts kalkulieren, weil wir zu wenig wissen. Wir wissen zu wenig von den Wahrscheinlichkeiten. Und weil wir zu wenig von diesen Wahrscheinlichkeiten wissen, haben wir uns an Regeln zu halten, die uns ‚zur Sicherheit‘ gegeben worden sind. Diese Regeln wurden allerdings von Instanzen und Institutionen aufgestellt, die auch sehr wenig von diesen Wahrscheinlichkeiten wissen. In diesem Nichtwissen haben wir uns einzurichten. Sowohl wir wie auch die Instanzen und Institutionen, die an der Aufstellung der Regeln beteiligt sind. Dazu gehört nun auch die Wissenschaft, die entgegen dem ersten Anschein unablässig dabei ist, etwas zu schätzen. Ohne Schätzungen könnte es überhaupt nicht zu Maßnahmen kommen: Die Wissenschaft schätzt, die Politik verhängt oder lockert. Niemand kann im Vorhinein oder nachher die Risiken berechnen, die durch die Lockerungen dieser oder jener Maßnahme entstehen, niemand aber auch die Risikoverringerung berechnen, die sich der Verhängung dieser oder jener Maßnahme verdankt. Und um aus aktuellem Anlass noch eine Binsenweisheit anzuführen: Schätzungen tendieren dazu, tendenziös zu sein. Aber dagegen gibt es ein Mittel – oder sollte es geben: Über Schätzungen lässt sich vernünftig reden.
Worum es mir im Moment geht, ist aber das Schätzen des Einzelnen, das allerdings mit dem der der Instanzen und Institutionen oftmals auf eine fatale Weise verknüpft ist. Zunächst einmal ist uns ja das Schätzen nur begrenzt erlaubt. Wir können ein Risiko gering einschätzen, laufen aber, wenn wir deswegen den Maßnahmen zuwiderhandeln, Gefahr einstweilen geächtet oder bestraft zu werden. Anders kann es ja auch nicht sein – die Maßnahmen sind ja nicht auf den einzelnen Fall zugeschnitten, sondern scheren verschiedene Fälle über einen Kamm. Der Ärger darüber wird umso größer sein, je verschiedenartiger die Fälle sind. Aber gerade deswegen begehen diejenigen einen Denkfehler, die aus der Maßnahme den Schluss ziehen, dass diese im Einzelfall auch vernünftig ist. Der Maßnahme haben wir – aus der Sicht des Staates – im Einzelfall zu gehorchen, weil sie die Maßnahme ist, nicht weil sie vernünftig ist.
Ob wir uns an eine Maßnahme halten wollen oder nicht, können wir in Anbetracht möglicher Konsequenzen frei entscheiden, aber unser Denken und Schätzen sollte sie nach Möglichkeit nicht in Mitleidenschaft ziehen. Nur geschieht gerade dies derzeit im allergrößten Maßstab. Die Leute nehmen sich gewissermaßen die Freiheit, von einer Schutzmaßnahme auf das Risiko zu schließen, das eingegangen wird, wenn ihr zuwidergehandelt wird. Ohne ihren Verstand zu gebrauchen und für den bestehenden Fall das Risiko einzuschätzen. Dass die Leute meist nicht in der Lage sind, Risiken für Leib und Leben realistisch einzuschätzen – dass sie beispielsweise mehr Angst davor haben, in ihrer Wohnung einem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen als an Hautkrebs zu sterben usw. – ist bekannt und wird immer wieder beklagt. Das Eigentümliche an der jetzigen Situation ist aber, dass die Leute zu einer unrealistischen Einschätzung von Risiken gleichsam erzogen werden (ohne dass das jemand so intendierte). Man schätze mal das Risiko, sich zu infizieren, wenn im Wald jemand den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht einhält, im Vergleich zum Risiko ab, ganz ordnungsgemäß in einem Schlachthof zu arbeiten. Oder das Risiko, zu dritt bei offenem Fenster in einem Büro der FernUniversität in Hagen zu sitzen, im Vergleich zum Risiko, in ein Asylbewerberheim in Bayern eingepfercht zu sein. Vor allem aber ist eine vernünftige Einschätzung der Gefahren am Platze, mit denen diese Pandemie überhaupt verknüpft ist. Nur ein Beispiel. Auf Tagesschau.de konnte man am 15. 11. 2019 lesen: „Das Robert Koch-Institut hat neue Zahlen zu Infektionen in Kliniken veröffentlicht. Demnach sterben jährlich schätzungsweise bis zu 20.000 Menschen durch Krankenhauskeime. Vor allem immungeschwächte Patienten sind gefährdet.“ Weiterhin gebe es „nach aktuellen Schätzungen jährlich bis zu 600.000 Krankenhausinfektionen“; und 3,6 Prozent der Patienten im Krankenhaus infizieren sich laut dieser Studie mit einem multiresistenten Keim. Übrigens: Einen Impfstoff gibt es gegen diese Keime natürlich nicht. Man schätze das gegen die Risiken ab, die nach derzeitigem Infektionsstand in Sachen Corona eingegangen werden können.
Schätzen heißt: sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Um zum Schluss ein ganz großes Geschütz aufzufahren, hier noch einmal die ersten Sätze eines der wichtigsten Texte der europäischen Geistesgeschichte: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
Eine zerstreute Grille über Realismus in der Corona-Krise
29. Mai 2020 | Prof. Dr. Uwe Steiner
In diesen Tagen gewinnt eine seinerzeit vielbeachtete wissenschaftssoziologische These eine neue Anmutungsqualität. Gewiss ist es richtig, dass die Entdeckung des Milchsäurebazillus das soziale Band verändert hat. Zugleich war damit die These verknüpft, es gebe ihn, den Bazillus, erst, seit Pasteur ihn im Labor entdeckt hatte. Eine umstrittene Behauptung, die, um klingen zu können, spezifischer Resonanzräume bedurfte. An erster Stelle ist hier das voraussetzungsreiche Sprachspiel der konstruktivistischen Erkenntnistheorie zu nennen. Aller Schwierigkeiten zum Trotz, oder gerade ihretwegen, brachte es für die Milieus, in denen es gespielt wurde, den Vorteil einer gewissen Schibboleth-Qualität mit sich. Die noch auf Fakten beharrten, konnten beschieden werden, sie argumentierten essentialistisch. Jetzt, da ein neuer Erreger die sozialen Bänder mal dehnt, mal verkürzt, darf man die Labor-These der Wissenschaftssoziologie natürlich nicht mit der Erzählung vom chinesischen Labor verwechseln, dem das SARS-CoV-2-Virus angeblich entsprungen sei. Warum der derzeit mächtigste Konstruktivist – er sitzt im weißen Haus – diese Verschwörungstheorie so vehement verbreitet, liegt auf der Hand. Mit der Schuldzuweisung kann er seinem Stil gemäß Politik betreiben, und zudem gelingt ihm die wenn auch vulgäre Zurechnung eines naturförmigen Geschehens auf Kultur.
Ein paranoischer Wahn sei das Zerrbild eines philosophischen Systems, lehrte die Psychoanalyse. Wie leicht das Genre der Theorie verschwörungstheoretische Züge annehmen kann, zeigt die aktuelle Lage. Den Regierungen lagen Pandemie-Szenarien und Maßnahmenkataloge seit Jahren vor, als tatsächlich eintrat, was vorhergesagt wurde. Aber sie zögerten, ihre Macht einzusetzen. Das Zaudern der Politik sprach nicht eben für totalitäre Tendenzen oder den Willen zur Machtergreifung. Trotzdem argwöhnte ein Starphilosoph, Covid-19 sei bloß eine Variante der Grippe und die Krise nichts als ein Vorwand der Mächtigen, den Ausnahmezustand auf Dauer zu stellen. Ihnen sei es um Herrschaft und uns nur ums nackte Leben zu tun. Eines wie auch immer zu beziffernden Risikos wegen opferten wir unsere Werte. Indem wir den Nächsten nurmehr als potentiellen Ansteckungsherd wahrnähmen, schloss der Philosoph, stehe der wahre Feind nicht draußen, er lauere in uns. So lautet in Reinform die konstruktivistische These: Was wir als äußere Realität wähnen, sei in Wahrheit eine Schöpfung interner Verfahren. Tatsachen gebe es nicht, sondern nur Tathandlungen. Das Faktum leite sich nicht nur etymologisch von lat. „facere“, machen, her.
Natürlich werden Statistiken fabriziert. Und statistisch gesehen mag Covid-19 für Individuen bloß ein Risiko darstellen. Für die Gesellschaft aber handelt es sich um eine Tatsache, auf die Politik reagieren muss. Hier lassen die Modelle keine Spielräume für Ungewissheit. Das hat Michael Coors in der NZZ vom 7.5.2020 klar gemacht: „Denn was in individueller Perspektive nur ein vages Erkrankungsrisiko ist, stellt sich mit Blick auf die Gesellschaft als das bekannte und absehbare exponentielle Wachstum einer Epidemie dar. Dass sich grosse Teile der Bevölkerung infizieren werden, wenn nichts unternommen wird, ist kein Risiko, sondern ein Wissen, das auf Erkenntnissen epidemiologischer Forschung beruht.“
Dass Vorhersagen, die eintreffen, ein Wahrheitskriterium darstellen, ist keine sonderlich originelle Aussage. Aber sie bewährt sich mitunter. Dagegen muss man in den Humanities einen erheblichen Begründungsaufwand betreiben, um die These plausibel erscheinen zu lassen, dass die Wirklichkeit wirklich ist und dass es reale Dinge auch jenseits der Verfahren gibt, sie zu konstruieren. Auch das ist nicht neu. Die Debatte ist intellektuell immer wieder reizvoll und mindestens so alt wie der Idealismus. Sie spricht darum nicht notwendig gegen unsere Disziplinen. Aber sie erklärt, warum man gegenwärtig Virologen und Epidemiologen auch dann eher zuhört, wenn es nicht primär um medizinische Sachverhalte geht. Auch sie sind sich nicht einig. Aber sie alle dürften überzeugt sein, es mochte SARS-CoV-2 gegeben haben, noch bevor Virologen es identifizierten. Etwaigen Vorwürfe, das sei eine essentialistische Aussage, dürften sie gelassen entgegensehen.
Dass die Dinge in Wahrheit nicht so sind, wie sie oberflächlich oder dem Uneingeweihten erscheinen, diese Überzeugung teilen konstruktaffine Theorien in den Humanities strukturell mit Verschwörungstheorien. Selbstredend gibt es Unterschiede, darunter solche ums Ganze. Letztere kennen die Akteure, wissen, wer schuld ist, wer die Verblendungen produziert und von ihnen profitiert. Die Lehren der ersteren mögen zwar auch verschworene Anhänger finden. Aber sie dienen erkennbar einem anderen Zweck.
Der Satz, der Milchsäurebazillus existiere erst, seit Pasteur ihn entdeckt hatte, klingt erst einmal ziemlich gaga und ist es wohl auch. In seinen Kontexten leistet er jedoch etwas, das sich zu Verschwörungstheorien ziemlich entgegengesetzt verhält. Mit dem Verblüffungseffekt der kontraintuitiven Sprechweise lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Verfahren im Labor, auf die Darstellung und das Aussagen von Wahrheit. Der Satz legt offen, dass er selbst ein Konstrukt ist. Aus ihm erhellt, dass sich das Ausgesagte, die wissenschaftliche Wahrheit, relativ zum Aussagen verhält. Hingegen würde keine Verschwörungstheorie je ihren Konstruktcharakter einräumen wollen.
Die Relativität des Ausgesagten auf die Pragmatiken des Aussagens ist auch realistischen Positionen, und gerade ihnen, nicht verborgen geblieben. Sie gilt aber auch und zuvörderst umgekehrt! Es verhält sich nicht nur das Dargestellte relativ zur Darstellung, sondern letztere sich auch relativ zum Gegenstand. Wer sich nicht von Sachimpulsen des Dargestellten bestimmen ließe, um stattdessen einzig an den Parametern der Darstellung zu drehen, liefe eben Gefahr, abzudrehen. Das Theoriegeschäft in den Humanities lebt von der Kontraintuition: Im neuen Licht auf eine bislang nur vermeintlich bekannte Sache erstrahlt auch die Theoretikerin. Aber wo und wann schlägt die Kontraintuition um in Konspiration, wird das Licht zur Blendung? Ab wann wird der Abweichler zum Guru, die Innovatorin zur Ikone, die Schule zur Gemeinde?
Wir erleben derzeit, wie etwas, das wir nicht gemacht haben, eine banale biologische Realität, etwas mit uns macht, genauer: etwas mit unserem Machen macht. Das könnte eigentlich einen Realismusschub motivieren. Stattdessen wuchern Verschwörungstheorien. Eine nicht leicht zu fassende Querfront von Impfgegnern, Rechts- und Linksextremen, von Fremdenfeindinnen- und feinden, Regierungs-, Kapitalismus- und Globalisierungskritikerinnen und -kritikern geht auf die Straße und ignoriert nicht allein das physische Abstandsgebot. Dass manche der dort verlauteten Positionen - wie leise auch immer - in den universitären Milieus widerhallen, lässt die Frage nach dem Sicherheitsabstand zur Verschwörungstheorie umso dringlicher erscheinen. Um sie zu stellen, müsste man die Diffusionszonen besser kennen, in denen sich wissenschaftliche Konsensus mit unter Autoritätsdruck vorgebrachten Einigkeiten innerhalb der „Community“ berühren. „Gemeinschaften“ bilden sich um Überzeugungen herum und sind daher interessiert, diese zu bewahren. Sie halten sich in spezifischen Hallräumen. Auch die Universität stellt ein Milieu dar, das die Pflege von Ideen jenseits von Erfahrungen begünstigt. Das gilt verstärkt für Denkmilieus, die sozialpolitische und moralische Agenden verfolgen. So sympathisch das jeweilige Anliegen auch ausfallen mag: Bedenklich wirkt, wie oft die Agierenden die Verantwortlichen dafür zu kennen glauben, dass die Wirklichkeit den hochgesteckten Idealen nicht entspricht: Wenn alles, was ist, gemacht ist, dann muss jemand schuld daran sein. Die Prämisse, die Sichtweise von Dingen sei ihrer Wirklichkeit vorgelagert, befördert die Tendenz, nach immer kleineren Splittern im Auge der anderen zu suchen. So tritt an die Stelle der eigentlich wissenschaftlichen Tugend, der Kultivierung von Dissens, leicht der moralisierende Ausschluss der Gegenposition, genauer: der Personen, die sie vertreten. Irgendwann stehen die Tribes einander immer unversöhnlicher gegenüber.
Die Corona-Krise aber betrifft alle. Vermittelt sie womöglich die Milieus und Generationen übergreifende Erfahrung einer geteilten Wirklichkeit? Einer Wirklichkeit, ich wiederhole mich, an der wir mitgewirkt, die wir aber nicht gemacht haben. Wir sind nicht gemacht, alles gemacht zu haben, sagte Jean Paul.
Unsicherheitsgefühl
26. Mai 2020 | Prof. Dr. Peter Risthaus
Auch was wir nicht wissen, wissen wir durch Medien; dieses Paradox macht unsicher. Wer einer Gefahr zuvor kommen, sie gar abwehren möchte, tut gut daran, entsprechende Anzeichen, Ratschläge und Warnungen ernst zu nehmen, damit Schäden nicht eintreten, meinethalben an Leib und Leben. In den sonnigen Tagen der griechischen Antike schien das noch einfach. Man befragte ultimative Experten für das Schicksal, die Orakel. Sie wussten die Zukunft, sprachen allerdings – leicht berauscht – in Rätseln. Auch König Ödipus versank in elegisches Grübeln und wusste nicht weiter, als Theben der Pest anheim zu fallen drohte.
Die Priester hatten bereits abgewirtschaftet, d.h. die Brandopfer der Bevölkerung – statt Atemmasken wurden noch Ölbaumzweige verteilt und auf den Altären ins Feuer geworfen – helfen nichts mehr. Und wenn nichts mehr hilft, soll es meinethalben Vernunft richten. Wer wäre da besser geeignet, als der große Rätsellöser Ödipus, der sogar die Sphinx im Wettstreit besiegte und deshalb zum König ausgerufen ward. Die Priester flehen ihn an: »Wohlan denn, bester König, rette unsere Stadt, triff, bitte, Vorsorge!«1So schickt er seinen Schwager Kreon zum Orakel nach Delphi, um dort nachzufragen, was denn in dieser Situation zu tun sei?
Die weitere Geschichte ist bekannt: Das Orakel gibt den Rat, jenen zu bestrafen, der Ödipus Vorgänger im Amte getötet habe, dann würde die Pest schon aus der Stadt verschwinden. Aber leider war er es einst selbst: Ödipus sollte als Kind auf Geheiß der Eltern, wiederum aufgrund eines anderen Orakelspruchs, der besagt er würde den Vater töten und die Mutter ehelichen, von einem Diener getötet werden. Letzterer brachte es nicht übers Herz. Ödipus wird als Findelkind von einem anderen Königspaar aufgezogen und erschlägt an einer Kreuzung im jugendlichen Affekt seinen leiblichen Vater. Er dachte es handele sich um einen Räuber. Dass er diesen Fall jetzt auch noch selbst aufklären muss und feststellt nicht nur der Richter, sondern auch Täter (und sein eigener Henker) zu sein, ist tragisch zu nennen.
Friedrich Hölderlin wird die Tragödie des Sophokles entsprechend deuten und behaupten: „König Ödipus hat ein Auge zu viel, vielleicht.“2 Er deute den Orakelspruch zu ›unendlich‹, d.h. er will einfach zu viel wissen, was zu seiner Vernichtung, aber auch zur Erfüllung (nicht allein) seines Schicksals führt.
Heute haben solche Orakel wiederum abgewirtschaftet. Der moderne Mensch treibt ohne Schicksal dahin und ist den Zufallswellen ausgesetzt, die um den Globus kreisen. Stattdessen gibt es Experten und komplexe Frühwarnsysteme, die anschlagen sollen, wenn kritische Werte erreicht sind. Das gilt für Erdbeben und Tsunamis ebenso, wie für autonomes Fahren und die Verbreitung von Viren ›im‹ und außerhalb des Internets. Auch hat jeder heute blinkende Rauchmelder in seiner Wohnung, staatlich verordnet, um aufzuwachen, bevor es zu spät ist, von den Überwachungseinrichtungen der sogenannten Smart Homes ganz zu schweigen: »Wohlan denn, bester König, rette unsere Stadt, triff, bitte, Vorsorge!«. Die neue Botschaft der Macht lautet: Wir können uns unserer selbst niemals sicher genug sein, weder beim Rauchen oder Autofahren noch in Ansteckungsfragen. Für Kontingenzbeseitigung sorgen Assistenzsysteme oder Tracing Apps. Letztere haben, nicht nur ›vielleicht‹, mehr als ›ein Auge zu viel‹. Eine andere Lebenskunst wäre es, mit Unsicherheit leben zu können, denn je mehr wir wissen, desto weniger auch.
[1] Sophokles: König Oidipus. In: Werke in zwei Bänden. Hg. u. übers. v. Dietrich Ebener. Berlin 1995. S. 262.
[2] Friedrich Hölderlin: »In lieblicher Bläue ...«, in: Sämtliche Gedichte. 4. Aufl., hg. v. Jochen Schmidt. Frankfurt a.M. 2019. S. 479.
Die sinnstiftende Frage nach dem Ursprung von Epidemien
19. Mai 2020 | Dr. Fabian Fechner
Die Frage nach dem Ursprung – keine Epidemie verging, ohne dass diese mit Nachdruck gestellt wurde. Nicht nur, dass mit ihr Wege der Ansteckung nachvollzogen werden sollen, um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen. Mit ihr sollen Charakter und Wesen des Unbeherrschbaren und Furchteinflößenden umrissen und Verantwortlichkeiten geklärt werden.
Eine Epidemie als Verschwörung, Sühneleistung oder Strafgericht Gottes, dies alles sind Deutungen, die heute noch im kollektiven Gedächtnis sind. Die Pest als Folge der angeblichen Brunnenvergiftung, die ethnischen und religiösen Minderheiten angelastet wurde, ist ein bekanntes Beispiel. Neben diskriminierenden Erklärungsmodellen wurden auch Erdausdünstungen oder unheilvolle Sternkonstellationen verantwortlich gemacht.
Solche Annahmen wirken heute als Botschaften aus einer fernen, finsteren Vormoderne, als allzu fadenscheinige Sündenbocktheorien. Wie eng allerdings die wissenschaftlichen „hard facts“ mit soziokulturellen Gestimmtheiten verwoben sind kann ein sehr viel jüngeres Beispiel zeigen, das eindeutig in den Bereich der „modernen“ Wissenschaft fällt: dasjenige der Cholera im 19. Jahrhundert. Der in Berlin lehrende Südasienhistoriker Michael Mann hat für die verheerende Cholerapandemie von 1832, die keinen Kontinent verschonte, die Atmosphäre der Unsicherheit nachgezeichnet:
„Zwar hatte sich die Cholera, wie gesehen, auf dem Seeweg im Indischen Ozean und dem Chinesischen Meer ausgebreitet. Aus europäischer Sicht jedoch, viel wichtiger, war die Epidemie auf dem Landweg über den Mittleren Osten und Russland nach Europa gelangt. Schutzlos war die Bevölkerung der neuen Krankheit ausgeliefert, die vorwiegend in den Städten einen hohen Tribut an Erkrankungen und Toten forderte. Bekämpfungsmaßnahmen, wie sie seit Pest und Pocken bekannt waren, wie die Isolation von Kranken und das Ausräuchern von Häusern, zeitigten keinerlei Ergebnisse. In ihrer Ohnmacht verdächtigte die städtische Bevölkerung, wie gehabt, die Juden, die Brunnen vergiftet zu haben. Voller Misstrauen weigerte sie sich aber auch, dem Rat der Ärzte zu folgen oder Lazarette aufzusuchen. Behörden, Wissenschaftler und Politiker waren gleichermaßen ratlos, was anhand der zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitungen, Journalen und Broschüren ersichtlich wird. Allein in den Jahren 1831/32 wurden zwölf Zeitschriften gegründet, die sich ausschließlich mit der Cholera beschäftigten. In ihnen wurden ständig wechselnde Theorien über Ursachen, Verlauf und Verbreitung der Krankheit präsentiert, die die Leserschaft freilich immer wieder aufs Neue verunsicherten.“ (Mann 2015, 390f.)
Zwischen zwei Gruppen gab es auf der Suche nach dem Choleraerreger einen heftigen Schlagabtausch: Auf der einen Seite standen die Miasmatiker, welche die Auffassung vertraten, dass die Cholera auf giftige Dämpfe, die sogenannten Miasmen, zurückzuführen sei. Die Krankheit wurde somit als lokal gebunden gesehen. Die Kontagionisten hingegen sahen den Übertragungsweg der Krankheit in verunreinigtem Trinkwasser. Diese Auffassung mündete schließlich in Robert Kochs bakteriologischer Theorie.
Insbesondere von der britischen Kolonialregierung in Indien wurde die Miasmentheorie favorisiert. Sie passte vor allem deshalb ins Konzept, weil sie den Handel kaum einschränkte. Durch die Ortsgebundenheit machte sie aufwendige Quarantänebestimmungen unnötig. Außerdem war die Cholera dadurch in Gebiete und besondere Klimate fern der europäischen Zentren verbannt. Mit einem Zivilisationsgefälle zwischen Europa und Indien und einer grundsätzlichen Bedürftigkeit der fernen Überseegebiete konnte somit auch auf dem Feld der Seuchen argumentiert werden.
Doch Koch war seinerseits nicht der bahnbrechende Neuerer, wie die klassische Wissenschaftsgeschichte vermittelt. Er hatte einige Vordenker, vor allem den toskanischen Mediziner Filippo Pacini und den englischen Arzt Arthur Hill Hassall. Auf sie mag Foucaults Diktum zutreffen, dass sie noch nicht „im Wahren“ sprachen, dass sie an den Institutionen und dem Wissenschaftsduktus ihrer Zeit vorbei noch auf kein Publikum zählen konnten.
Hier lohnt es sich, nach Pest und Cholera einen Blick auf die Syphilis zu werfen. Sie ist nicht nur als eine der ersten epidemisch auftretenden Infektionskrankheiten in den Schriftquellen konkreter festzumachen als viele andere Plagen. Auch forschungshistorisch ist sie hochspannend. Auf ihr Beispiel bezieht sich ein großer wissenssoziologischer Wurf des 20. Jahrhunderts, Ludwik Flecks Werk „Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache“ (Erstauflage von 1935). Gerade am Syphiliserreger erläutert der jüdisch-polnische Mediziner und Bakteriologe (nicht etwa Historiker oder Soziologe!), dass wissenschaftliche Tatsachen nicht einfach objektive, unveränderliche Fakten sind. Sie werden vielmehr von einem „Denkkollektiv“ allmählich ermöglicht, formuliert und vorgebracht, das sich durch eine bestimmte „Denkstilgebundenheit“ auszeichnet. Wissenschaftliche Tatsachen sind somit geschichts- und kulturabhängig. Fleck wählt als Beispiel, wie verschiedene Deutungen und Einbettungen des Syphiliserregers zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert aufeinanderfolgen: die mystisch-ethische Deutung der Krankheit als göttliche Strafe für sündige Lust, die empirisch abgesicherte Behandlung mit Quecksilbersalben, verschiedene experimentell-pathologische Syphilisbegriffe, der Gedanke des verdorbenen Blutes der Syphiliskranken und schließlich bakteriologische Vorstellungen (Fleck 1980, 3-29). Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der Fleck die Diffusität des Krankheitsbildes beschreibt, das im Rückblick als scharf definiert erscheint:
„Es ist sehr schwer, wenn überhaupt möglich, die Geschichte eines Wissensgebietes richtig zu beschreiben. Sie besteht aus vielen sich überkreuzenden und wechselseitig sich beeinflussenden Entwicklungslinien der Gedanken, die alle erstens als stetige Linien und zweitens in ihrem jedesmaligen Zusammenhange miteinander darzustellen wären. Drittens müßte man die Hauptrichtung der Entwicklung, die eine idealisierte Durchschnittslinie ist, gleichzeitig separat zeichnen. Es ist also, als ob wir ein erregtes Gespräch, wo mehrere Personen gleichzeitig miteinander und durcheinander sprachen, und es doch einen gemeinsamen herauskristallisierenden Gedanken gab, dem natürlichen Verlaufe getreu, schriftlich wiedergeben wollten. Wir müssen die zeitgleiche Stetigkeit der beschriebenen Gedankenlinie immer wieder unterbrechen, um andere Linien einzuführen; die Entwicklung aufhalten, um Zusammenhänge besonders darzustellen; vieles weglassen, um die idealisierte Hauptlinie zu erhalten. Ein mehr oder weniger gekünsteltes Schema tritt dann an die Stelle der Darstellung lebendiger Wechselwirkung.“ (Fleck 1980, 23)
Fleck (1980, 29) überrascht mit der Feststellung, dass trotz der bakteriologischen Fundierung des Syphilisbegriffs „eigentlich gar nichts abgeschlossen wurde“, dass die Definition einer Krankheit also immer noch im Fluss ist.
Fleck konnte auf fünf Jahrhunderte zurückblicken und ordnend deuten – und hat ganz nebenbei am Beispiel des Syphiliserregers den erhellenden und unaufgeregten Begriff des „Denkkollektivs“ geprägt. Ich bin jetzt schon auf das Handbuchkapitel der „Geschichte des frühen 21. Jahrhunderts“ gespannt, das uns sinnstiftend, erzählend und gliedernd mit etwas Abstand von der großen Wucht der Gleichzeitigkeit befreien wird. Vielleicht wird es auf den Spuren Flecks auch ein bisschen zum „Ursprung“ der Seuche beitragen können. Die Palette der Angebote hinsichtlich des Corona-Virus (bzw. Covid 19) ist derzeit groß. Wer mit dem brasilianischen Staatspräsidenten Bolsonaro meint, dass es sich bei der gegenwärtigen Pandemie um eine „kleine Grippe“ handele, negiert bereits die Neuheit des Phänomens, nicht nur deren Ausmaß. Verschwörungsanhänger glauben eher an eine künstliche Entstehung des Virus in einem chinesischen Labor (wobei das Virus dann wahlweise beabsichtigt oder unbeabsichtigt entwichen wäre), einige chinesische Autoritäten an den infizierten US-amerikanischen Soldaten, der den Erreger während der Militärspiele 2019 nach Wuhan eingeschleppt haben soll (Hoffmann/Knobbe 2020, 21). Miasmische Anklänge weckt die Szene des Fischmarktes, auf dem auch mit Wild gehandelt wurde, wo die Mutation und der Übergang des Erregers auf den Menschen gleichsam als Rache einer geschundenen Natur scheint. Jede Erzählung des Ursprungs liefert somit auch ein bisschen Sinn mit, der dem Geschehen gegeben werden soll.
Verwendete Literatur
Fleck, Ludwik 1980: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, hg. v. Lothar Schäfer und Thomas Schnelle, Frankfurt am Main.
Hoffmann, Christiane/Martin Knobbe 2020: Interview mit Wu Ken, chinesischer Botschafter in Deutschland, in: Spiegel, Nr. 20/9.5.2020, S. 20f.
Mann, Michael 2015: Cholera in den Zeiten der Globalisierung. Oder wie die Welt in zwei Teile zerfällt, in: Ders./Jürgen G. Nagel (Hg.): Europa jenseits der Grenzen. Festschrift für Reinhard Wendt, Heidelberg, S. 389-431.
Corona und das Geistesleben
13. Mai 2020 | Eryk Noji
In seinem Essay „Die Großstädte und das Geistesleben“ von 1903 beschreibt Georg Simmel die Mentalität von Großstädter*innen als eine geistige, auf dem Verstand basierende – ganz im Gegensatz zu Kleinstädter*innen und deren Mentalität auf Grundlage von Gemüt und Gefühl. Was Simmel damit thematisiert, ist eine gesteigerte Individualisierung der Großstädter*innen, die sich in einem Durcheinander und Gedränge von Menschen wiederfinden und sich mit der Ausbildung eines eher intellektualistischen Charakters als „Präservativ“ (Simmel 1995: 118) gegen diese „Steigerung des Nervenlebens“ (ebd.: 116) schützen müssten. Da so viele Reize auf den Menschen einprasseln, werde er zunehmend blasiert, also unfähig zur Verarbeitung derselben und damit gewissermaßen abgestumpft. Weil es mental unmöglich sei, auf die Vielzahl der Begegnungen in der Großstadt zu reagieren und weil man auch nicht all diesen unbekannten Menschen trauen könne, sei man in der Großstadt zu einer Reserviertheit gezwungen, „infolge deren wir jahrelange Hausnachbarn oft nicht einmal von Ansehen kennen und die uns dem Kleinstädter so oft als kalt und gemütlos erscheinen lässt“ (ebd.: 123). Diese Reserve manifestiere sich dabei unter der Hand nicht nur als Gleichgültigkeit, sondern als eine latente Aversion.
Nun, in Zeiten des Corona-Virus, heben die Kontaktbeschränkungen das Simmelsche „Präservativ“ auf eine neue Stufe, denn die Distanzierung soll nun physisch vollzogen werden, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. „Abstandhalten ist der neue Alltag“ so RKI-Präsident Wieler. Michael Niehaus hat in seinen Überlegungen zu Unsicherheitsfaktoren treffend dargelegt, wie das social distancing darauf aufbaut, andere und sich selbst als Unsicherheit aufzufassen, denn jeder und jede einzelne könnte infiziert sein, ohne davon zu wissen. Es wird angemahnt, diese Unsicherheit stets zu bedenken und deshalb gerade nicht unseren Gefühlen und (Kontakt-)Bedürfnissen nachzugeben, sondern uns aus Vernunft in eine Haltung der Reserviertheit zu begeben (Intellektualismus), in der wir andere Menschen auf Abstand halten und damit einer Leiblichkeit Ausdruck verschaffen, die unter normalen Bedingungen auch als Ablehnung (latente Aversion) interpretiert werden könnte. Das verschiebt große Teile des Soziallebens in die digitalen Sphären, denen – mehr noch als der Großstadt – schon immer eine überfordernde Reizüberflutung attestiert wurde. Folgt man Simmel, dann dürfte die neue Mischung aus Homeoffice, Sozialkontakten und ständig neuen Nachrichten zum Corona-Virus dann auch zu einer Art digitalen Blasiertheit führen.
Allerdings sah Simmel diese mentale Distanz der Großstadt gar nicht so negativ, wie es zunächst klingen mag: „Sie gewährt nämlich dem Individuum eine Art und ein Maß persönlicher Freiheit, zu denen es in anderen Verhältnissen gar keine Analogie gibt.“ (Simmel 1995: 123f.) Die im Zuge der Verdichtung des Großstadtlebens erfolgende Distanznahme erlaube eine Unabhängigkeit, die, so führt Rolf Lindner (2018: 533) aus, „als eine Befreiung von Bevormundung erfahren wurde“ und damit als „ein zentrales Motiv der Zuwanderung in die großen Städte“ gelten kann. Wichtiger werden damit aber auch überindividuelle Zeitregime, die für Simmel mit der Verdichtung der Sozialbeziehungen in der Großstadt und ihrem intellektualistischen, mental distanzierten Charakter unmittelbar verbunden sind. Die Beziehungen und Interessen der vielen Menschen seien so vielfältig und kompliziert, dass „ohne die genaueste Pünktlichkeit in Versprechungen und Leistungen das Ganze zu einem unentwirrbaren Chaos zusammenbrechen würde“ (Simmel 1995: 120).
Diese Zeitregime haben allerdings ihre ganz eigenen Probleme. Wettbewerbs- und Effizienzorientierung sowie der Zwang zur Beschleunigung, so die Beobachtung von Hartmut Rosa und Vera King, haben den Zeittakt der späten Moderne so stark bestimmt, dass Menschen im Versuch, ihren To-do-Listen hinterherzukommen, nicht mehr zu den Dingen kommen, die ihnen eigentlich wichtig sind. Und so äußern Rosa und King angesichts der Corona-Krise vorsichtig die Hoffnung: „Vielleicht lässt sich die gegenwärtige Stillstellung der materiellen und physischen Bewegung in vielen sozialen Bereichen als eine Art Moratorium nutzen, um über die Schieflage im Verhältnis von Wichtigem und Dringlichem nachzudenken.“
Dreht man die beschriebene Simmelsche Entwicklungslogik also um, dann könnte die physische Entwirrung durchaus auch zur Erosion des Zeitregimes und eventuell sogar zur mentalen Wiederannäherung führen. Zumindest zu Beginn der Kontaktbeschränkungen konnte man diesen Eindruck haben, wurden sie doch immer wieder mit Solidarität und damit mit einem geistigen Zusammenrücken begründet, und wurden ihre möglichen Auswirkungen eben auch im Sinne von ‚Entschleunigung‘ und ‚Weltreichweitenverkürzung‘ interpretiert (Rosa). Mittlerweile ist aber „der gesellschaftliche Motor wieder angesprungen“, wie Armin Nassehi es formuliert. Man muss Nassehis Diagnose einer eigenlogischen und in diesem Sinne unsteuerbaren Gesellschaft nicht uneingeschränkt teilen, um festzustellen, dass eingespielte Routinen und gesellschaftliche Dynamiken ziemlich veränderungsresistent sind. Die Bundesländer geraten in einen Wettbewerb um Lockerungen, die gesellschaftlichen Teilsysteme und ihre Funktionslogiken gewinnen wieder an Relevanz.
Strikte Hygienemaßnahmen sollen nun den Spagat zwischen altem Leben und neuer Distanz schaffen. Wenn man so will, dann ergänzt die physische Distanz die mentale Distanz nun als eine Art Schutzschild bei möglichst gleichbleibender Dynamik der Gesellschaft. Die von Simmel beschriebene Dynamik wird dann nicht umgekehrt, sondern lediglich ergänzt. Dies lässt sich dann als ein weiterer Schub der Tendenz der Vereinzelung lesen, wie sie die Individualisierungsdiskussion immer schon begleitet. Schon vor Corona waren Stimmen zu vernehmen, die unseren Gesellschaften einen „Berührungsmangel“ bescheinigten. Die Kuschelparties, die vor einiger Zeit in den Medien präsent waren und die sich wohl leicht als Reaktion auf diesen Mangel interpretieren lassen, sind auch vor dem Hintergrund der diversen Lockerungen undenkbar. Selbst der Händedruck sollte unterbleiben. Berührungen aber sind wichtig für die psychische und physische Gesundheit des Menschen und das Fehlen von Berührung macht krank, so lassen sich viele kürzlich erschienene Artikel und Interviews zu dem Thema kurz zusammenfassen. Da ist es nur konsequent, dass Merle Fairhurst vermutet, dass die Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten psychische Folgen haben werden.
Das macht eine grundlegende Ambivalenz sichtbar. Wenn man es extrem formulieren will, dann wird durch die Distanz also eine Pandemie mit einer anderen bekämpft – die Pandemie des Virus gegen die Pandemie vertiefter Vereinzelung. Nimmt man den Hinweis auf psychische Folgen der physischen Distanz ernst, dann wird sich also in jedem Fall etwas ändern, wenn auch nicht im Rahmen eines Moratoriums beabsichtigt. Das soll nun keinesfalls behaupten, dass die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Corona-Virus grundsätzlich schlecht seien. Aber es weist auf die Widersprüchlichkeit hin, mit der vermutlich jede Form von Unsicherheit behaftet ist. Das Virus wird uns noch eine ganze Weile begleiten, so viel scheint leider sicher. Damit wird sich aber auch die Frage nach dem Verhältnis von Nähe und Distanz immer wieder stellen.
Literatur
Lindner, Rolf (2018): Stadt, Großstadt. In: Hans-Peter Müller und Tilman Reitz (Hg.): Simmel-Handbuch. Begriffe, Hauptwerke, Aktualität. Berlin: Suhrkamp, S. 531-535.
Simmel, Georg (1995): Die Großstädte und das Geistesleben. In: Rüdiger Kramme, Angela Rammstedt und Otthein Rammstedt (Hg.). Georg Simmel. Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908. Band I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 116-131.
Zur Expertenkultur in der Corona-Krise
07. Mai 2020 | Dr. Dennis Schmidt
Kaum eine Figur eignet sich dermaßen als Projektionsfläche, ja als Figuration von (Un-)Sicherheit, wie „der Experte“ – hier bewusst in der maskulinen Form gehalten, da er uns gegenwärtig derart eindeutig geschlechtlich codiert gegenübertritt. Die aktuelle Situation interpretieren manche als Ausdruck einer „Expertokratie“, der Heidelberger Politikwissenschaftler Reinhard Mehring scheut sich nicht – gewissermaßen selbst aus der Position eines Experten – eine „Diktatur der Virologen“ zu attestieren. Zugleich scheint die Skepsis gegenüber etablierten Expertenkulturen der „Wissensgesellschaft“ zu wachsen, wie beispielsweise der US-amerikanische Politologe Tom Nichols und mit anderem Zungenschlag der Schweizer Frühneuzeithistoriker Caspar Hirschi betonen.
Das Verhältnis von Krise und „Experte“ ist mehrschichtig:
- Krisen legen – so eine klassische Lesart – Strukturen offen, zeigen, wer Macht hat und wer nicht. Wenn nun Expertesein vor allem bedeutet, andere davon zu überzeugen, dass das eigene Wissen das Richtige ist, dann hängen Macht und Expertise unmittelbar zusammen.
- Die Krise legt aber nicht einfach nur Strukturen offen, sondern entfaltet eine spezifische Dynamik – ausgelöst, aber nicht bestimmt, durch die schlichte biologische Existenz und Verbreitung des Virus‘ –, in der Experten überhaupt erst gemacht werden. Experte ist somit eine Bedeutungszuschreibung, die sich prozessual vollzieht.
- Eine Krise ist schon der Wortherkunft nach eine Entscheidungssituation. Damit ist für politische Akteure, aber auch die Gesellschaft insgesamt, die Entscheidung verbunden, welchen Stimmen man Gehör schenkt und welchen eben nicht. Für die Medien heißt die Frage: Wen lade ich als Experte ein und mache ihn damit zu einem solchen? Diese notwendige Eindeutigkeit steht indes in schroffem Gegensatz zum wissenschaftlichen Diskurs, der idealerweise durch Offenheit, Vorläufigkeit und Differenzierung geprägt ist. Unter anderem daraus entstehen Irritationen und Konflikte in der gegenwärtigen Corona-Krise.
Aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive erstaunt die Bedeutung von Experten in einer Krisensituation nicht, eine vermeintliche Besonderheit oder gar Exzeptionalität unserer Gegenwart liegt darin nicht begründet. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es in Zeiten, die Menschen als Krise erleben, der Normalfall ist, dass Experten gemacht werden. Historisch hochvariabel sind jedoch die spezifischen Expertenkulturen. Und hier scheint sich zumindest im hegemonialen Diskurs unserer Zeit eine massive Dominanz eines disziplinär zergliederten Systems „Wissenschaft“ zu zeigen, wobei sich schon im Fall der „Klimakrise“ eine Deutungshegemonie naturwissenschaftlicher Ansätze offenbart. Caspar Hirschi betont, dass die Entstehung des „modernen“ Experten, der Begriff selbst stammt allerdings erst aus dem 19. Jahrhundert, in der Frühen Neuzeit durch die Zuschreibung von Spezialwissen und Unbefangenheit geprägt war. Und gerade diese Faktoren sind für Experten die Basis für Vertrauen, gerade sie werden von gegnerischer Seite in Zweifel gezogen. Hirschis Beobachtung hingegen, dass wir nach „einem Expertenkult der jüngeren Vergangenheit“ eine „Expertenschelte der Gegenwart“ (Hirschi, Skandalexperten, S. 13) erleben, bestätigt sich interessanterweise mehrheitlich, wenn auch nicht ausschließlich, in der derzeitigen Krise in Deutschland nicht. Geradezu stellvertretend für „die“ Wissenschaft agieren Exponenten einiger medizinischer Fachrichtungen (Virologie, Epidemiologie). Zu anderen Zeiten wäre die Rolle anderer Gruppen, seien es Geistliche, Astrologen, Juristen oder Militärs, sehr viel größer gewesen. Zuletzt haben wir erlebt, wie politische Entscheidungsträger und „ihre“ Experten öffentlich gemeinschaftlich auftraten, performativ eine Einheit bildeten; quasi ein hybrider Leviathan, der je nach Standpunkt Figuration der Sicherheit oder Unsicherheit sein kann.
Spannend zu beobachten ist, dass auch die Gegner dieses Leviathans trotz vermeintlicher Ablehnung des „Mainstreams“ vielfach auf eine ähnlich gelagerte Expertenkultur rekurrieren. Sie bringen Gegenexperten hervor, für die gerade „wissenschaftliche“ Qualifikation eine große Rolle spielt: So werden akademische Titel konsequent hervorgehoben. Diese Gegenexperten scheinen vor allem in zwei Typen aufzutreten:
- „Der Praktiker“, der sich aus vermeintlich eigener Erfahrung (beispielsweise als praktizierender Arzt) gegen die vermeintlich weltfremden Experten in den Laboren und Schreibstuben wendet.
- „Der Dissident“, der selbst wissenschaftlich ausgewiesen ist, aber scheinbar von einer ignoranten oder verkommenen Mehrheit kleingehalten wird.
Letztlich speisen sich aber Experten sowie Gegenexperten aus der gleichen Logik. Zumindest in Deutschland scheinen Gegenexperten ohne wissenschaftliche „Weihen“ oder empirische Argumentationsmuster nur eine geringe Rolle zu spielen.
Die Beschäftigung mit der Figur des Experten ist in der gegenwärtigen Situation sinnvoll und spannend. Nicht jedoch, um ihm gegenüber eine prinzipielle Skepsis entgegenzubringen, sondern vielmehr, um eine reflektierte Distanz gegenüber verschiedenartigen Bedrohungsrhetoriken der Gegenwart zu gewinnen. Nicht zuletzt aber auch uns selbst gegenüber, die wir mit diesem Blog eine Expertenstellung (für gesellschaftliche Reflektion) einzunehmen zumindest in Anspruch nehmen.
Zitierte Literatur:
Caspar Hirschi, Skandalexperten, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems, Berlin 2018.
Ein unwissenschaftlicher Beitrag zur Krisenreflexion
30. April 2020 | Jun.-Prof. Dr. Irina Gradinari
Dass in unserem Blog bislang nur Männer schreiben, ist kein Zufall. Die Krise hat uns auf verschiedene Weisen getroffen und vielleicht sonst nicht sichtbare und verdeckte Hierarchien und Differenzen teilweise verschärft und teilweise verschoben – darauf haben präziser und ausführlicher der Beitrag von Maximillian Waldmann und das YouTube-Video von Vanessa Thompson aufmerksam gemacht. Ich möchte diese Beobachtungen durch den Hinweis ergänzen, dass nicht alles, was wir hier und heute erleben, durch bestehende Wissensparadigmen erklärt oder gerahmt werden kann. Joseph Vogl hat diesen Kampf um „hermeneutische Vorsprünge“ für die eigenen Deutungsmuster kürzlich treffend auf den Punkt gebracht. Vor diesem Hintergrund scheint mir notwendigerweise ein ‚anderes‘ Wissen von Bedeutung, das situativ und subjektiv ist, zunächst eher aus Beobachtungen besteht – und mit dem ich meinen Sorgen Ausdruck verleihen möchte:
- Der Staat, über den auch Michael Niehaus schreibt, tritt uns gegenüber gegenwärtig in einer neuen Form auf, die noch genauer zu untersuchen ist. Dabei hat der Staat jedoch nicht nur eine starke Regulierung öffentlicher Bereiche und auch eine neue performative Praxis des Kollektiven (durch Verzicht auf einige Grund- und Bürger-Rechte) gefordert, sondern zugleich auch viele Bereiche vernachlässigt. Der Staat ist daher nicht überall. Gerade umgekehrt hat sich der Staat eigentlich aus vielen Bereichen zurückgezogen, etwa aus Familien-, Bildung- und arbeitsrechtlichen Bereichen, was Menschen mit prekärer Existenz besonders getroffen hat und zudem den Schultern der Frauen* neue Lasten aufbürdet. Die erschütternde Erkenntnis ist, dass die deutsche Gesellschaft eine zutiefst patriarchale ist, in der Fürsorge, Hausarbeit und Kinderziehung weiterhin vorwiegend in der Verantwortung der Frauen liegen.
- Aus diesem Grund scheint es auch kein Zufall zu sein, dass eine besondere Produktivität gefordert wird, die aus der Krise unbedingt gewonnen werden soll: Wie alles, soll auch sie Profit werden. Wenn Care-Arbeit und (Für-)Sorge als solche nicht anerkannt werden, hat es freilich den Anschein, dass alle nur zu Hause ‚sitzen‘ und sich langweilen – die Feuilletons sind voller Vorschläge, wie mit dieser Langeweile, der ganzen freien Zeit umgegangen werden könnte. Der Naheliegendste besteht natürlich darin, einfach noch mehr zu arbeiten. Zum Beispiel in der Online-Lehre, die eben nicht nur darauf reduziert ist, ein paar Stunden die Woche ein Chat-Programm zu bedienen, sondern vielmehr in der Forderung mündet, rund um die Uhr sieben Tage pro Woche online verfügbar zu sein. Das verursacht eine völlige Entgrenzung der Arbeit und des Privaten. In dieser Situation sind interessanterweise nicht nur die arbeitenden Frauen, ältere Kolleg*innen (die mit neuen Technologien nicht mühelos umgehen können oder wollen), Verwaltungsmitarbeiter*innen, die auch die Funktionsweise der Computer besonders angewiesen sind, und technisch und finanziell nicht ausgerüstete Studierende betroffen, sondern auch Informatiker*innen und IT-Berater*innen, die nun im Dauereinsatz bleiben müssen, damit es alles störungsfrei läuft und die neue Ideologie der vernetzten Isolation legitimiert wird. Denn Online-Systeme werden nun als große Chance gesehen, öffentliche Bereiche nahezu vollkommen zu ersetzen.
- Erschütternd erscheint dabei auch der neue Selektionsmechanismus der „Systemrelevanz“, durch den der Staat nun viele Tätigkeiten abwertet sowie wie selbstverständlich neue Hierarchien einführt. Diese neuen Teilungen und neuen Bewertungs- und Abwertungsskalen sind aus vielerlei Sicht phantasmatisch: Einerseits werden auf einmal Berufe aus der Bildung und Kultur nicht mehr als relevant angesehen. Doch wer möchte ein System am Leben erhalten, das per Gesetz viele Qualifikationen in diesen Bereichen einfach als irrelevant erklärt? In den USA gelten selbst Wrestling und Pferderennen als systemrelevant (s. z.B. hier), in Deutschland mancherorts nicht einmal Erzieherinnen und Lehrerinnen, geschweige denn Informatiker*innen, die nun rund um die Uhr Online-Systeme flicken. Andererseits gesteht der Staat mit seiner Verleihung der Auszeichnung „Systemrelevanz“ etwas verschämt und hinter der neutralen Lexik von Rettungs- und Pflegediensten verborgen ein, dass er eben doch auf die Care-Arbeit von Frauen angewiesen ist. Denn hinter diesen Begriffen verbergen sich in der Regel schlecht bezahlte und prekär beschäftigte Frauen*, die den Ärzt*innen assistieren, kranke und alte Menschen pflegen, Dienststellen putzen, Regale in Supermärkten füllen und an der Kasse sitzen – und höchstwahrscheinlich ganz ähnliche Dinge für ihre Ehemänner und Kinder tun müssen, sobald sie nach der Arbeit nach Hause kommen. Das große Geld aber verdienen immer noch mehrheitlich Männer, deren Berufe auf einmal selbst aus Sicht des krisengeschüttelten Staates erstaunlich wenig Systemrelevanz besitzen.
Warum wir alle* ungleich gleichbetroffen von der Krise sind
14. April 2020 | Dr. Maximilian Waldmann
Aus einer transdisziplinären Perspektive, wie sie die intersektionale Geschlechterforschung verfolgt, bieten Krisen die Chance, ritualisierte gesellschaftliche Deutungsmuster in den Blick zu nehmen, die bestimmten Fehlschlüssen unterliegen und die in ‚normalen‘ Zeiten kaum problematisiert werden. Zwei dieser Irrtümer zeigen sich meines Erachtens besonders aktuell:
1) Wir sind alle* gleichbetroffen,
2) ein handlungsfähiger Staat kann jetzt für Sicherheit sorgen.
1) Der Ort, an dem wir schreiben, beeinflusst, was und wie wir schreiben. In der Akademie und auch außerhalb. Jetzt gerade sitzen einige von uns an den heimischen Schreibtischen und können sich in Ruhe ihrer Arbeit widmen. Einige genießen dabei das Privileg, zu selbst gewählten Zeiten, konzentriert und ungestört arbeiten zu können, während andere mit den ‚suboptimalen‘ materiellen Bedingungen des Home Office in vollem Umfang konfrontiert werden. Dazu zählt die Doppelbelastung von Erwerbs- und Sorgearbeit – das heißt, gleichzeitig Mahlzeiten zuzubereiten, Alltag auf neue Weisen für mich und andere zu organisieren, ständig verfügbar zu sein für die Jüngsten, während der Berg an Arbeit, die ‚zwischendurch‘ auch irgendwie erledigt werden muss, stetig zunimmt. Mit Blick auf diese doppelte Vergesellschaftung von Frauen, wie es die Soziologin Regina Becker Schmidt (1987) einst formulierte, erweist sich das vielfach beschworene Mantra der Gleichbetroffenheit von der Krise bereits unter den höchstprivilegierten Akademiker*innen als Illusion, zumal auch hier wie für alle anderen Schichten gilt: Frauen verrichten den Großteil der gesellschaftlich notwendigen Sorgearbeit und tragen die Hauptarbeitslast in neoliberalen Gesellschaften.
Ein Blick aus dem Elfenbeinturm heraus offenbart noch mehr. Neben der Ungleichverteilung von Arbeitslasten verschärft die Corona-Pandemie auch die Auswirkungen der bereits bestehenden Ungleichverteilung von Vulnerabilität und Prekarität, wenn sie als Effekte historisch gewachsener Herrschaftsformationen begriffen werden. Darauf hat die postkoloniale Theoretikerin und Soziologin Vanessa Eileen Thompson mit dem Terminus der rassialisierten, vergeschlechtlichten und klassenbasierten Triage hingewiesen (Link zu Youtube). Das Wort Triage (vom Frz. trier – ‚aussortieren‘), bekannt geworden in Zusammenhang mit der prekären Lage in Italien, bezeichnet in der herrschaftskritischen Reformulierung von Thompson Selektionsmechanismen, die bereits vor jeder Möglichkeit auf medizinische Behandlung wirken. Thompson illustriert dies an einem Fall vom 21.03.2020 aus London, wo Kayla Williams, eine 36jährige Mutter von drei Kindern, an den Folgen einer Corona-Infektion zuhause starb. Dies geschah, nachdem ihr die Notfallmediziner, die ihr Partner am Tag zuvor verständigt hatte, mitteilten, dass ‚ihr Fall keine Priorität‘ für eine stationäre Behandlung habe, obwohl die junge Frau offensichtlich an heftigen Symptomen wie akuter Atemnot und Reizhusten litt. Der Fall, so Thompson, zeigt wie bereits viele andere in der Corona-Krise auch, dass mehrfach marginalisierte Menschen gar nicht erst im Krankenversorgungssystem aufgenommen werden, weil sie durch die epistemischen Raster fallen, was als behandlungsnotwendig gilt. Im Fall von Kayla Williams, einer woman of color, spielen die seit mehreren Jahrhunderten gewachsenen kolonialrassistischen wie klassenbezogenen Herrschaftsmechanismen eine entscheidende Rolle. Untermauert wird dies von Thompson mit dem Hinweis auf die rassialisierende und nicht selten misogyne Inskription von Hyperstärke, die dazu führt, dass den schwarzen Körpern, ähnlich wie auch den Körpern der Mütter, jegliche Form von Vulnerabilität abgesprochen wird, wodurch ihre Bedürfnisse und Nöte nicht wahrgenommen werden. Alle*, so ließe sich mit Judith Butler (2005, 2009) sagen, – das sind eben nur diejenigen, deren Tod auch betrauert wird oder werden kann, weil sie innerhalb der Ordnungen des Sicht- und Sagbaren anerkennbar sind. Die Fehleinschätzung vieler Privilegierter, dass wir alle* von der Krise gleichbetroffen seien, sollte der Erinnerung an das – vielfach unsichtbare – Leid derjenigen weichen, die nicht zuhause bleiben können, weil sie keines haben, weil ihnen dort Gewalt droht, weil sie geflüchtet oder pflegeabhängig sind, oder weil sie ‚den Laden am Laufen halten müssen‘, wie beispielsweise ein Blick in den Care-Arbeitssektor veranschaulicht.
2) Zweifellos verschärft die Corona-Krise auch die Sorge-Krise. Sorgeverhältnisse korrespondieren bekanntlich mit dem Angewiesen-Sein auf Andere, weshalb der Rückzug auf eine selbstbezügliche Position des ‚Ich-bin-nicht-betroffen‘ den lebensnotwendigen Aspekt des Mitseins mit Anderen verkennt. Müssten wir dann in unserer Wahrnehmung nicht auch alle* von der Sorge-Krise mit-betroffen sein? Ganz so einfach ist es wohl nicht. Die Tatsache, dass Frauen auch im Care-Arbeitssektor die Hauptarbeitslast unter hochgradig prekären Bedingungen tragen und einigen (Männern) von uns erst jetzt bewusst wird, dass Sorgearbeit keine Anerkennung erfährt und zur unsichtbaren und jederzeit voraussetzbaren Ressource geworden ist, offenbart ein Strukturmerkmal postfordistischer Gesellschaften. Die Philosophin Tove Soiland (2016) hat es als symbolische Nicht-Existenz der mütterlichen Gabe bezeichnet. ‚Karrieretypen‘ und der berüchtigte ‚self-made-man‘, den es eigentlich gar nicht geben kann, weil wir nicht als ‚selbstsorgende‘ Wesen existieren können, genießen in unserer symbolischen Geschlechterordnung höchstes Ansehen, während der Bezug zur mütterlichen oder sorgenden Anderen häufig abgewertet und ausgebeutet wird, dabei jedoch unsichtbar bleibt. Zur Feminisierung der Reproduktionsarbeit passt leider nur zu gut, dass weite Teile des gegenwärtigen Präventionsdenkens androzentrisch verfasst sind, wie neben anderen Brigitte Aulenbacher (2009) gezeigt hat. So argumentiert auch Isabel Lorey (2012) in ihrer Kritik an modernen Sicherheitsdiskursen in der Nachfolge von Thomas Hobbes, der die Unterwerfung unter den Staat mit Sicherheitsgewinnen für den Einzelnen begründet hatte, dass dabei unreflektiert patriarchale Maßstäbe und heteromännliche Subjektnormen dominieren, die das bürgerliche Subjekt als universales legitimieren. „Diesen bürgerlich-männlichen Positionierungen [sind] geschlechtliche Herrschaftsverhältnisse ebenso immanent […] wie Dominanzbeziehungen gegenüber jenen, die nicht als Bürgerinnen eines jeweiligen Staates zählen“ (Lorey 2012: 68). In dieser Konstruktion können Sicherheit und Schutz nur von denjenigen beansprucht werden, die die bürgerlich-männliche Subjektnorm repräsentieren, sich ihr unterordnen oder ihr entsprechen können. In Kombination mit modernen Diskursen der Selbstsorge, wie sie Michel Foucault beschreibt, in denen es um die möglichst souveräne Beherrschung des eigenen Körpers und der Bedingungen geht, die seine Existenz sichern, wird das männliche Phantasma der eigenen Unabhängigkeit von Anderen verstärkt, während die Angewiesenheit auf (Für-)Sorge und die Vulnerabilität der eigenen Existenz ausgeblendet werden (vgl. Lorey 2012). Beide Diskurse produzieren und zentrieren zugleich fähige, unversehrte Körper, die nicht altern. Was passiert, wenn der androzentrische Sicherheits- und der egozentrische Selbstsorgediskurs in der aktuellen Krise aufeinandertreffen, hat der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen dokumentiert. In seinem Blog beschreibt er, wie die Situation von Menschen mit Behinderung besonders jetzt völlig unbeachtet bleibt und beispielsweise Einrichtungen zur Eingliederungshilfe, ähnlich wie Pflegeeinrichtungen, im Gegensatz zu Krankenhäusern nicht im Fokus von Behörden und öffentlicher Anteilnahme stehen. Eine ‚sichere‘ Trennung von Infizierten und Nichtinfizierten sowie eine Isolierung von Kranken sind hier kaum möglich. Der moderne Sicherheitsdiskurs scheitert in diesen wie auch in zahlreichen anderen Fällen, weil er keine Gesellschaft denken kann, in denen Abhängigkeitsstrukturen nicht allein von wirtschaftlicher Art sind, sondern durch vergeschlechtlichende, heterozentrische, rassistische, klassistische, ableistische u.a. miteinander verschränkte Dominanzverhältnisse reguliert werden.
Bereits vor der Corona-Krise war eine Kritik an Diskursen über (Un-)Sicherheit und ihre Ablösung von androzentrischen Wissensökonomien eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur interdisziplinär bewältigt werden kann. Jetzt, wo es einmal mehr darum gehen könnte, Sorgebeziehungen (anders) zu denken, sind reflektierte Antworten auf diese epistemische Herausforderung aus den jeweiligen Bezugsdisziplinen, die zu Figurationen von (Un-)Sicherheit forschen, notwendiger denn je.
Literatur
Aulenbacher, Brigitte (2009): Die soziale Frage neu gestellt – Gesellschaftsanalysen der Prekarisierungs- und Geschlechterforschung. In: Castel, M./Dörre, K. (Hrsg.): Prekarität. Frankfurt/M, New York, S. 65-80.
Becker-Schmidt, Regina (1987): Die doppelte Vergesellschaftung – die doppelte Unterdrückung: Besonderheiten der Frauenforschung in den Sozialwissenschaften. In: Unterkirchen, L./Wagner, I. (Hrsg.): Die andere Hälfte der Gesellschaft. Österreichischer Soziologentag 1985. Wien, S. 10–25.
Butler, Judith (2005): Gefährdetes Leben. Politische Essays. Frankfurt/M.
Butler, Judith (2010): Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt/M.
Lorey, Isabel (2012): Die Regierung der Prekären. Wien.
Soiland, Tove (2016): Die mütterliche Gabe hat keine symbolische Existenz. Interview mit Tove Soiland. In: Dolderer, M./Holme, H./Jerzak, C./Tietge, A.-M. (Hrsg.): O Mother, Where Art Thou? (Queer-)Feministische Perspektiven auf Mutterschaft und Mütterlichkeit. Münster, S. 203-213.
Unsicherheitsfaktoren
10. April 2020 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Es ist wichtig, mit Trivialitäten zu beginnen: Jeder von uns ist ein Unsicherheitsfaktor. Er oder sie könnte das Virus in sich tragen, er oder sie könnte ein spreader sein. Die Atemschutzmaske ist das Zeichen, das uns daran erinnert. Das gilt allerdings nur, solange er oder sie das nicht weiß. Ich bin ein Unsicherheitsfaktor für die anderen, solange ich nicht weiß, dass ich infiziert bin. Wenn ich hingegen infiziert bin, werde ich zu einer Gefahr für die anderen. Da ich im täglichen Leben auf der Straße nicht wissen kann, ob die anderen nicht wissen, dass sie infiziert sind, genügt es einstweilen, sie als Unsicherheitsfaktoren zu betrachten. Ganz gleich, wie minimal die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie infiziert sind, muss ich daher mehr oder weniger so tun, als ob ich wüsste, dass sie infiziert sind. Das sogenannte social distancing funktioniert so, dass eine Infizierung ausgeschlossen sein soll, auch wenn der andere sich infiziert hat. Das ist Vorschrift. Darin sind sich alle gleich! Es ist die Gleichheit aller Untertanen-Subjekte, weil sie alle einen Körper haben, mit dem sie jemanden infiziert können. Sogar diejenigen, die gar keine richtigen Untertanen sind, weil sie sich illegal in Deutschland aufhalten.
Der Staat, der das social distancing verfügt, setzt damit eine Kategorie außer Kraft, die im Zusammenleben der Menschen eine entscheidende Rolle spielt: das Vertrauen. Ob ich persönlich darauf vertraue, dass dieser oder jene nicht infiziert ist, darf keine Rolle spielen (die Mitglieder meiner Hausgemeinschaft freilich ausgenommen). Wie kann man auch darauf vertrauen? Man kann ja nicht wissen, ob der andere nicht jemandem vertraut hat, dem er nicht hätte vertrauen sollen. Nun ist das Vertrauen allerdings keine maßlose Kategorie. Es ist nicht so, dass man durch die Welt geht und entweder vollstes Vertrauen hat oder eben nicht. Es gibt Abstufungen. In uns residiert gewissermaßen ein kleiner Kalkulator, der mutmaßlich verquere Risikoabschätzungen darüber anstellt, ob es zum Beispiel ‚sicher genug‘ ist, dass man sich mal ‚mit Freunden‘ trifft, wenn man ‚aufpasst‘, dass man sich nicht ‚zu nahe‘ kommt usw. Solchen Versuchen des Selbstdenkens bzw. solchem Vertrauen in die eigene Mündigkeit traut der Staat – oder genauer: die Obrigkeit – nun eben nicht. Deswegen sind die Verbote ja kategorisch. Sie gelten für alle gleich. Im Leviathan von Thomas Hobbes – um noch einmal auf diesen Grundtext der abendländischen Staatsphilosophie zurückzugreifen – ist der Staat dafür zuständig, den bellum omnia contra omnes des Naturzustands zu beenden. Das geschieht ebenfalls durch eine Art social distancing: Der Friede soll sozusagen dadurch einkehren, dass niemand dem anderen so nahe kommt, dass er ihm einfach den Schädel einschlagen kann. Den Staat gibt es, weil wir für einander Unsicherheitsfaktoren sind. Man sieht: Einerseits hat sich wenig geändert, und andererseits hat sich alles geändert, wenn wir einander zu Unsicherheitsfaktoren qua Infektion geworden sind.
Und hier beginnen die Trivialitäten aufzuhören. Die Untertanen daran zu hindern, sich in großem Stil den Schädel einzuschlagen, ist sehr viel einfacher, als sie daran zu hindern, sich gegenseitig zu infizieren. Zu letzterem sind nicht nur Verbote zu erlassen und eine Polizei auf den Weg zu schicken, sondern es muss auch gepredigt werden. Nie dürfen wir vergessen, dass wir einander per se Unsicherheitsfaktoren sind. Dazu sind – unter anderem – die im Kraftfeld des Staates stehenden Medien da, die uns das auf allen Kanälen vor Augen halten. Aber trotz aller Medien ist die Gefahr des Selbstdenkens bzw. der Unbotmäßigkeit nicht auszurotten. Für den Staat ist daher jeder von uns ein Unsicherheitsfaktor. Und darauf reagiert er mit einer spezifischen Form der Pädagogik, nämlich jener, die mit der Angst arbeitet. Es gibt Eltern, deren pädagogische Maßnahmen dazu führen, dass das Kind auf der Straße jeden freundlichen älteren Herrn als jemanden sieht, der es womöglich im nächsten Moment in sein Auto zerrt. Natürlich ist derjenige ein guter Untertan, der sich nach den Verboten richtet. Sicherer ist es aber, wenn die Leute die Verbote aus Angst befolgen. Bei Hobbes haben die Menschen sich zusammengetan, um die Furcht voreinander abschaffen bzw. durch die Furcht vor den Verboten des Staates zu ersetzen. Jetzt hingegen muss der Staat regieren, indem er den Leuten Angst einjagt. Das ist zunächst einmal keine Kritik, sondern eine Feststellung: So funktioniert’s. Der Staat soll für Sicherheit sorgen und muss für diesen Endzweck zugleich auch das Gefühl der Unsicherheit verstärken.
Problematisch sind auf jeden Fall die Begleiterscheinungen. Natürlich möchte der Staat beweisen, dass er erfolgreich im Kampf gegen das Virus ist, dass er die richtige Strategie gewählt hat, dass er die richtigen Mittel einsetzt, dass er die Lage unter Kontrolle bringen wird. Aber dazu gehört eben auch, dass man, wie es jetzt signifikant heißt, ‚nicht zu früh Entwarnung‘ gibt und die Risiken ‚auch für die Jungen‘ nicht ‚herunterspielt‘. Das heißt: Es gehören eben auch Propagandamittel aller Art dazu. Und hier ist die Grenze zur Desinformation fließend. Täglich werden uns etwa die Infektionskurven vorgehalten: Die notorische Aussage, dass die Zahl der Infektionen abermals gestiegen ist, ist wenigstens noch korrekt – wenn auch nicht dazu gesagt wird, dass sie ja gar nicht fallen können. Gerne wird aber auch die Zahl der Infektionen mit der Zahl der Infizierten gleichgesetzt. Das ist auch nicht manifest falsch, weil ja immerhin bei jeder Infektion jemand infiziert wurde. Aber letztlich ist für uns und unser Unsicherheitsgefühl die Zahl der aktuell Infizierten interessant, in die die inzwischen Gesundeten und die Verstorbenen nicht eingehen. Und man muss schon etwas länger suchen, bevor man eine seriöse Grafik (zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften) findet, an der sich ablesen lässt, dass die Zahl der aktuell erfassten Infizierten seit einigen Tagen im Sinken begriffen ist. Die Zeiten, in denen man es für besser hält, den Untertanen zur Sicherheit nicht alles zu erzählen, werden nie vergehen.
Nachdenken über den Staat
30. März 2020 | Prof. Dr. Michael Niehaus
Wenn man erstens im Rahmen des interdisziplinären Forschungsthemas Figurationen von Unsicherheit und zweitens aus der Perspektive der eigenen Disziplin, Literatur- und Medienwissenschaft, über die sogenannte „Corona-Krise“ nachdenkt, dann fällt einem natürlich Vieles auf und ein. Wie auch aus Uwe Vormbuschs und Uwe Steiners Überlegungen hervorgeht, greift jeder unter diesen Voraussetzungen über das Gebiet seiner eigenen Disziplin hinaus. Aus diskursanalytischer Perspektive haben wir es derzeit mit einem Phänomen zu tun, in dem sich viele Diskurse und Diskursebenen überschneiden und überkreuzen: Nicht nur jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler hat etwas beizutragen – alle sind betroffen und haben etwas zu sagen. Anders ausgedrückt: Jeder und jede könnte zur „Corona-Krise“ interviewt werden. Und viele von uns hören sich im Fernsehen, im Radio, im Internet, in den Printmedien in erhöhter Intensität an, was andere zu sagen haben.
Die Unsicherheit ist der Horizont all diesen Sprechens. Nie war in den Medien und ‚unter den Menschen‘ so viel von unsicheren Prognosen, von Ungewissheit, von Verunsicherung, von drohenden Szenarien, von Risiken und Nebenwirkungen, von statistischen Wahrscheinlichkeiten und fehlenden Berechenbarkeiten die Rede. Die Unsicherheit involviert uns, sie involviert unsere Subjektivität – ganz gleich, ob wir als Experten oder als Betroffene das Wort ergreifen oder erteilt bekommen. Aber in was werden wir eigentlich genau involviert?
Ich denke, dass wir vor allem in den Staat involviert sind. Das ist nun sicherlich keine besonders bahnbrechende Erkenntnis. Denn der Staat ist es, der für unsere Sicherheit zu sorgen hat. Und nach Thomas Hobbes darf der Staat nur deshalb das unbeherrschbare Wesen – der Leviathan – sein, weil wir ihm die Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen, übertragen haben. Unser Staat, so sagt Uwe Steiner, sei „erkennbar nicht das Monster“ des Thomas Hobbes, sondern es sei – unter Bezugnahme auf das gleichnamige Buch von François Ewald – „der Vorsorgestaat, der handelt“, und in dessen „Systeme, könnte man sagen, investieren wir Vertrauen.“ Kann sein. Jedenfalls macht der Staat im Moment große Anstrengungen, dass wir ihm glauben. Aber das schließt gar nicht aus, dass er ein Monster ist. Die Restriktionen, welche – ich möchte es mit diesen alten Worten sagen – die Obrigkeit den Untertanen im Zuge der Corona-Krise auferlegt hat und auferlegt, führen uns ja zunächst einmal vor Augen, wozu der Staat in der Lage ist (und was wir womöglich vergessen haben). Der Staat kann alles Mögliche außer Kraft setzen, verschiedenste Maßnahmen erlassen und jederzeit Verbote aussprechen. Jetzt ist der Staat überall. Jedenfalls ist er unsichtbar überall mit dabei, wo das unsichtbare Virus sein kann. Und es ist unsicher, was er als Nächstes tun wird. Aber es ist auch unsicher und schwankend, wie wir uns dazu stellen.
Das sind alles keine Neuigkeiten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir diese Erfahrung machen, und dass uns diese Erfahrung fasziniert. Wir werden derzeit mit der Frage konfrontiert, was der Staat für uns ist. Auf diese Frage gibt es keine abschließende Antwort, schon gar keine wissenschaftliche. Denn sie rührt an den Grund unserer Subjektivität. Auf dem Höhepunkt der Krise, die mit den Worten Kontaktverbot und Ausgangssperre verknüpft ist, wird das Leben der Menschen idealiter auf zwei Entitäten reduziert: auf den Staat, der die Sicherheit im öffentlichen Raum wiederherstellen soll, und auf die Hausgemeinschaft, den Oikos. Schlagender kann nicht vor Augen geführt werden, worauf der Staat beruht (und was, nebenbei bemerkt, Obdachlosigkeit bedeutet). Er beruht darauf, dass es diese Trennung gibt, dass es einen Ort zum Wohnen gibt, an dem sich das Subjekt (auch und gerade vor dem Staat) sicher und geborgen fühlen können soll. Ohne diese Trennung wäre der Staat totalitär.
In unserer Kultur – die Kultur, in der die Staaten ‚erblüht sind‘ – ist die Hausgemeinschaft zunächst und zumeist familial, oder genauer: genealogisch strukturiert: Es gibt Eltern und es gibt Kinder. Wären die Eltern nur der verlängerte Arm des Staates, so wären sie keine Eltern. Aber auch umgekehrt: Gäbe es den Staat nicht, könnten die Eltern zu Monstern werden. Die Psychoanalyse hat uns gelehrt, dass wir nie aufhören, über unsere Eltern nachzudenken – zumal dann nicht, wenn wir uns in einer Krise befinden. Und ebenso gehört es zu unserem Subjektsein, dass wir auch „Über die Elternfunktion des Staates“ (so der Untertitel eines Buches des Rechtshistorikers und Psychoanalytikers Pierre Legendre) nicht aufhören können nachzudenken – zumal dann, wenn wir uns in einer Krise befinden.
Warum wir müssen wollen
26. März 2020 | Prof. Dr. Uwe Steiner
Wenn man als Literaturwissenschaftlerin oder Literaturwissenschaftler über die akute Corona-Krise nachdenkt, bietet sich an, Klassiker zu lesen. Das hilft immer. Diesen Rat hat auch schon so manches Feuilleton erteilt. Und er ist ja nicht verkehrt. Wer mit Unsicherheiten umgeht, versucht, Muster zu erkennen, und „klassisch“ darf heißen, was nicht nur normative, sondern erkenntnisfördernde Muster bereitstellt. Man könnte fragen, ob und wie die Corona-Parties dem dekadenten Fest in Edgar Allan Poes Die Maske des roten Todes ähneln. Vergleicht man die Einleitung zu Boccaccios Decamerone (1353) oder Daniel Defoes Bericht über die Pest in London 1665 mit Philipp Roths Roman Nemesis (2010), der eine Polio-Epidemie im Newark von 1944 zum Gegenstand hat, erkennt man gleichfalls Muster. Und sei es nur das erwartete, wie wenig sich im Umgang mit Epi- oder Pandemien geändert hat: Wie sie anfangs ignoriert, geleugnet, kleingeredet werden, um dann hastiges Handeln auszulösen. Wie Menschen menschlich reagieren, also Sündenböcke suchen oder großmütig handeln. Und natürlich wird man nicht an Thomas Manns Der Tod in Venedig vorbeigehen, darin Strategien der Verleugnung und des Nervenkitzels wiedererkennen und auch Albert Camus‘ Die Pest zu konsultieren nicht versäumen.
Das kann man machen, und wer die Klassiker noch nicht kennt, dürfte von ihrer Lektüre ebenso profitieren wie von einer Zimmerreise, jenem literarischen Genre, das um 1800 entsteht und das von Exkursionen ins eigene Intérieur erzählt, sei es ins empfindsame Selbst oder in die wohlausgestattete Stube. Eine Entüblichung der vertrauten alltäglichen Umgebung kann ja auch im Heimbüro derzeit nicht verkehrt sein.
Ich wähle jedoch einen anderen Zugang. Unter „Figurationen von Unsicherheit“ habe ich aus meiner sicherlich eingeschränkten literaturwissenschaftlichen Sicht immer auch konkret die Frage nach den Figuren verstanden. Also nach den rhetorischen oder symbolischen Darstellungsverfahren, die in einer akuten oder chronischen Lage der Unsicherheit oder der Ungewissheit dieselbe entweder repräsentieren oder kompensieren. Und zwar nicht nur in der Literatur, sondern auch im Leben selbst.
Die aktuelle Unsicherheit bzw. Ungewissheit betrifft ja nicht nur den Verlauf der Pandemie und den Erfolg der Maßnahmen. Hier können auch die Experten, Virologen und Epidemiologen, nur Mutmaßungen formulieren. Sondern auch die Frage nach den politischen Folgen. Wann und wie weit werden die restriktiven Regelungen, ungewohnt für eine sich als frei verstehende Gesellschaft, zurückgenommen? Michael Niehaus hat in seinem Verweis auf den Hobbes’schen Leviathan schon das Problem benannt: Unter welchen Umständen sind wir bereit, auf Freiheit, essentiell für unser Selbstverständnis als Individuen und als Gesellschaft, zu verzichten? Kein Mensch muss müssen, in diesem Diktum brachte ja Lessings Nathan die Verschränkung von Aufklärungs- und Freiheitsbegehren rhetorisch zündend auf den Punkt.
Kein Mensch muss müssen. Beurteile ich die Lage falsch, wenn ich wähne, dass wir, zumindest derzeit, den staatlichen Zwang, den Shutdown, die Kontaktverbote und Reiserestriktionen, in seiner Notwendigkeit weitgehend anerkennen? Wir müssen, noch zumindest, nicht nur müssen, wir wollen auch müssen. Wir treten Teile unserer Souveränität aus Einsicht, gewiss auch aus Furcht, an einen Leviathan ab, der erkennbar nicht das Monster ist, als das Hobbes ihn dargestellt hat. (Dessen Leviathan ist ja, nebenbei bemerkt, unschwer als Figuration zu erkennen: Siehe das Titelkupfer.) Es ist der Vorsorgestaat, der handelt. In seine Systeme, könnte man sagen, investieren wir Vertrauen.
Vertrauen muss sich rechtfertigen, um auch künftig investiert zu werden. Es kann dies aber nicht unter Bezug auf Sicherheiten, denn dann wäre es ja kein Vertrauen mehr. Vertrauen bedarf, anders gesagt, der Figurationen. Und hier versuche ich meinen Einsatz als Literaturwissenschaftler ins Spiel zu bringen. Ich begreife konkrete Dinge als Figurationen von Unsicherheit, als Realfigurationen sozusagen. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass unsere Mores oft in materielle Strukturen eingelassen sind, meine ich, dass Dinge als Figurationen sozusagen ontologische Sekurität vermitteln oder zumindest suggerieren können. Man kann sich an sie halten. Umgekehrt unterliegen sie aber auch dem Verdacht. Man kritisiert die Moral von Personen oder den sittlichen Zustand eines Gemeinwesens, wenn man „Verdinglichung“ am Werke wähnt oder Fetischisierungen beargwöhnt.
Und damit bin ich beim eigentlichen Thema. Kein Mensch muss müssen, richtig. Aber müssen müssen wir trotzdem. Nämlich – und jetzt fällt es schwer, die richtige Stillage zu treffen – unser Geschäft auch dann verrichten, wenn das Business in weiten Teilen stillsteht. Es gibt demnach ein Ding, in dem gegenwärtige Unsicherheiten gleichsam stellvertretend figurieren. Es ist auch schon viel glossiert worden, es ist, man ahnt es, das Toilettenpapier. Der derzeit vielgehortete Hygieneartikel bietet willkommenen Anlass zur Kritik der Mores, wenn sich im Hamstern das Allzumenschliche bekundet oder die mimetischen Rivalitäten eskalieren. Das steht in einer literarischen Tradition. Im Simplicissimus (1669), dem bedeutendsten Roman des deutschen Barock, gibt es ein einschlägiges Kapitel. In der damals schon etablierten Tradition der Dingbiographie erzählt ein „Schermesser“, ein Stück Toilettenpapier, seine Lebensgeschichte von der Geburt als Flachssamen bis zum Ende im Abort. Die letzte Geschäft steht in einer langen Reihe von Business-Aktivitäten, zählt der Roman doch minuziös alle materiellen Tätigkeiten und gewinnbringenden ökonomischen Transaktionen auf, an deren Ende das Wischpapier die ihm zugedachte Funktion erfüllt. Alles Wirtschaften, soviel ist sicher, ist zuletzt für das Gesäß. Das scheint Grimmelshausen sagen zu wollen, indem er in der barocken Tradition menschliche Eitelkeit glossiert. Dass uns unser materielles Begehren ins Unglück bringt, kann auch heute noch gewinnbringend artikuliert werden. Herfried Münkler meint, Corona sei die erste große Pandemie, die uns nicht der Krieg eingebracht habe, sondern die wir uns vielmehr durch Waren- und Menschenverkehr, durch sorglose Globalisierung und Menschenverkehr buchstäblich eingehandelt hätten. Vanitas Vanitatum! Wir werden umkehren müssen!
Weniger groß perspektiviert zeigt sich immerhin, wie brisant sich ein so niedriges Ding ausnehmen kann. In der Gesäßfrage steht einiges auf dem Spiel, auch der Staat. Wenn man Regierungsverlautbarungen hört, der Nachschub sei gesichert, aber vor leeren Regalen steht, kann Systemvertrauen schon einmal kriseln. Wir alle müssen zur Krisenbewältigung beitragen, gewiss. Aber das bleibt solange ein abstraktes „Wir“, solange es nicht konkret, im Ding, beglaubigt wird. Sicher ist, dass ich werde müssen müssen. In Zeiten der Unsicherheit halte ich mich ans Sichere, z.B. ans Papier. Das ist heikel, vor allem ist es aber komisch. Die Dinge des Unterleibs gehören seit je in die Komödie. Es gibt immerhin derzeit keinen Anlass, die apokalyptische Tonart anzuschlagen.
Vor allem zeigen Krise und Versuche ihrer Bewältigung uns eines: Von „neoliberalen“ Verhältnissen könnten wir derzeit weiter nicht entfernt sein, und wir sind, vermute ich, wohl auch vor der Krise weit von ihnen entfernt gewesen. Gewiss, im Zuge der Selbstertüchtigung und Selbstmobilisierung des flexiblen Subjekts haben die Coaches und Motivationsgurus uns immer wieder vermittelt, dass wir wollen müssen. In Wahrheit aber haben wir immer lieber müssen gewollt. Der Wille zum Müssen war schon da, bevor die Krise eintrat. Er musste sich nur sein Objekt bzw. seine Figuration suchen. Im Papier hat er es gefunden.
Corona und die Entgrenzung der Unsicherheit
26. März 2020 | Prof. Dr. Uwe Vormbusch
„Unsicherheit macht sich breit“, das hat Michael Niehaus in seiner Analyse von Kafkas Der Bau als den Kollaps einer letzten Endes pathologischen und selbst-destruktiven Sicherheitsfiktion herausgearbeitet. In Der Bau errichtet sich ein in Hinblick auf Herkunft und Gattung unbestimmtes Wesen eine Art Burg, welche es beherbergen und sichern soll. Im Laufe der Erzählung dringt das Gefühl einer allumfassenden Bedrohung jedoch immer tiefer in die Erfahrungswirklichkeit des Wesens ein. Unsicherheit macht sich auch heute breit. Sie ähnelt der Unsicherheit des Tieres in Kafkas Erzählung, insofern sie nicht nur das Außen im Sinne einer gefährlichen Umwelt bestimmt, sondern auch vom Innen Besitz ergreift: In der gegenwärtigen Corona-Hysterie ist jeder potenziell krank, jede eine mögliche Trägerin des Erregers, weshalb die an sich durchaus plausible Idee des social distancing in ihrer hysterischen Form auf komplette Isolation (der Alten, der Kranken) und damit auf gesellschaftliche Entsolidarisierung setzt. Beobachten kann man dies an den Reaktionsmustern führender Populisten, die im Anschluss an eine Phase der Leugnung – wie der britische Regierungschef – die sensible Lage Älterer, chronisch Kranker und weiterer Schutzbedürftiger ignorieren, indem diese in Großbritannien für zunächst drei Monate komplett isoliert werden.
Von der Pathogenese des Kafkaschen Tieres unterscheidet sich die gegenwärtige Krise vor allem durch die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung. Bevor die Unsicherheit das Tier auch in seinem ureigenen Bau befällt, verfügt es noch über eine klare, kognitive ebenso wie emotionale Trennung in ein sicheres Innen und ein unsicheres Außen. In seinen Beobachtungen ist das Tier in der Lage, zwischen der Sicherheit des Baus und der Unsicherheit der Umwelt zu unterscheiden. Erst allmählich zersetzt sich die gefühlte Sicherheit des Baus und Unsicherheit macht sich auch in seinem Inneren breit. Damit offenbart sich der konventionelle Aspekt gefühlter Sicherheit, die zu einem wesentlichen Teil auf Routinen und der habitualisierten Ausblendung des Auch-Anders-Möglichen beruht. Dass ‚da draußen‘ unbenennbare Gefahren und „Schwarze Schwäne“ vorkommen können, wissen wir. Wir sind aufgrund der Stabilität von Routinen und institutionalisierter Gewohnheiten aber in der Lage, dies schlicht zu ignorieren.
Die Diskussion darüber, ob Corona tatsächlich von ‚da draußen‘ kommt, also einen externen Schock darstellt, wie z.B. von neoliberalen Wirtschaftstheorien unterstellt wird, oder aber ein bislang verdrängter Teil eines Weltrisikosystems ist, welches die internen Widersprüche der gegenwärtigen Produktionsweise im Wortsinn zum Ausbruch bringt, hat dabei gerade erst begonnen. Dies ist nicht nur eine Diskussion darüber, in welcher Weise die globale wirtschaftliche Ausbeutung des Planeten ökonomische und soziale Auswirkungen in Gestalt der zunehmenden Ungleichheit von Lebenschancen und sozialer Klassen hervorbringt. Stattdessen wird die Diskussion darüber, ob unsere Wirtschafts- und Lebensweise sich verschärfende Krisen der gesellschaftlichen Naturverhältnisse mit sich bringt, nochmals erweitert.
Während der Klimawandel ein weithin wahrgenommenes und auch akzeptiertes Problem- und Handlungsfeld darstellt, gilt dies für ‚biologische‘ Katastrophen und ihre Hintergründe nicht im selben Maße. Zoonosen, also die Übertragung von Infektionskrankheiten über die Artenschranke hinweg, sind im Prinzip ja keine Unbekannten. Borreliose und Tollwut sind zwei Beispiele dafür. Dass ihre Zunahme nicht Teil eines von gesellschaftlichen Produktions- und Komsumtionsbedingungen getrennten Außen, sondern, z.B. in Gestalt einer massiv gestiegenen globalen Mobilität, des damit verbundenen ausdifferenzierten globalen Erlebnismarktes etc., Ergebnis derselben sind, wissen wir eigentlich auch, weil wir ein nicht unbedeutender Teil hiervon sind. In diesem Sinne ist Corona und die vom Virus mit betriebene ‚Entgrenzung der Unsicherheit‘ Teil einer sich ausbreitenden Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse.
Damit mag sich ggf. auch unsere Sichtweise auf die ‚Figurationen von Unsicherheit‘ und ihre relevanten Dimensionen erweitern. Die Natur schlägt nicht zurück, Corona gibt hier nur einen Blick frei auf zweierlei: erstens, in welcher Weise globale Wirtschafts- und Ungleichheitsstrukturen, Lebens- und Konsummuster die Wahrscheinlichkeit biologischer Krisen erhöhen, und zweitens, in welcher Weise unsere Gesellschaften hierauf reagieren. Hier hat die Systemtheorie sicher einen Punkt, denn was wir beobachten, ist nicht das Virus, sondern die Reaktion unserer Gesellschaften auf ein Ereignis, das wir gegenwärtig nicht als (kalkulierbares) Risiko eingrenzen können, sondern als Unsicherheit und Ungewissheit erfahren. Die Apparate laufen auf Hochtouren, diesen Status einer aus der Sicht der Moderne, ihrer Institutionen und ihres Selbstverständnisses unerträglichen Ungewissheit in ein kalkulier- und also beherrschbares Risiko zu transformieren.
Aber es gibt noch weitere Hintergründe für die gegenwärtig mit extremen Druck betriebene ‚Normalisierung‘ des Virus. Die massiven Reaktionen der Politik und die nun aufgelegten, in Größenordnung und Eingriffstiefe bislang unvorstellbaren Rettungsprogramme sind nicht allein aus den vorgebrachten offenkundigen Motiven der medizinischen Einhegung und der ökonomischen Stabilisierung verständlich. Kulturell verweisen sie auf die Behebung einer massiven Störung des klassisch modernen Versprechens rationaler Planbarkeit und Beherrschbarkeit. Im Moment gibt es keine verlässlichen Risikokalkulationen, keine institutionalisierten Programme, keine auf Bayes’sches Netzen beruhenden Wahrscheinlichkeiten, welche ein Regieren im Sinne eines an veränderte Kausalverknüpfungen angepassten ‚Weiter so‘ erlaubten. In diesem Sinne sind die hochrangigen Organe des gesellschaftlichen Risikomanagements gewissermaßen blind.
Politisch erleben wir als Reaktion hierauf eine eher ungewohnte Isomorphie von Entscheidungen, in der über alle politischen Parteien hinweg ganz ähnliche Deutungsmuster wirksam werden, und alle tun, was die anderen auch tun: nur keine Fehler machen, und ein fataler Fehler wäre ex post betrachtet, zu wenig getan zu haben. Das macht Relativierungen des Virus und seiner Gefährlichkeit gegenwärtig schwierig bzw. zu einem politischen und auch wissenschaftlichen Hazard. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass das skizzierte isomorphe Maximum genau das erreicht, was es verhindern will: eine gravierende ökonomische Krise mit massiven sozialen Folgen für unsere Gesellschaften.
Vor allem ist die Beispiellosigkeit der Krisenbewältigung als eine institutionalisierte Verdrängung zu verstehen: alles muss getan werden, damit verborgen bleibt, in welcher fatalen Weise die Politik in Hinblick auf die Daseinsvorsorge ihrer Bevölkerungen versagt hat, indem das gesellschaftliche Tafelsilber den Profiteuren des Finanzmarktkapitalismus übereignet wurde. Notfallbetten bringen keinen systematisch kalkulierbaren Profit. Dass dies heute nicht nur gesagt werden kann, sondern auch Gehör findet, ist ein Ergebnis des Kollapses unserer liebgewonnen Vorstellungen der Sekurität. Der Bau, so zeigt sich, war schon immer nicht genügend gesichert. Die Normalität dieser Fiktion ist zusammengebrochen. Mancherorts wird nun argumentiert, dass wir alle gleich sind, insofern wir vom Virus alle gleich betroffen seien. Tatsächlich aber sterben die Menschen ungleich. Sie sterben in den Altenheimen, und dafür gibt es Gründe. Sie sterben in Italien und in Spanien, und auch dafür gibt es – ökonomische und ideologische – Gründe der Verwandlung von Gesundheit in eine Ware (einschließlich der mitverkauften Sicherheitsfiktionen). Und sie werden, so ist zu befürchten, in den Slums von Neu Delhi und in den Flüchtlingslagern an der griechischen Grenze sterben.
Worin also bestünde das Gute, das die Krise in unseren Gesellschaften hervorbringen könnte? Gut wäre, das Virus als ein Beobachtungsinstrument zu verwenden, welches uns zeigt, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Und gut wäre, wenn mit den Sicherheitsfiktionen auch uneingelöste Gleichheitsfiktionen mit verabschiedet würden. Unsicherheit, so steht es im Basispapier der Forschungsgruppe ‚Figurationen von Unsicherheit‘, sei „nicht nur der Bezugspunkt von Strategien der Kontrolle und Vermeidung, sondern als Element von Diskursen, Institutionen und Konfigurationen produktiv“. Aus meiner Sicht ist es produktiv, die gegenwärtige VerUnsicherung zu nutzen, bevor der entstandene Raum der Unruhe mit den alten Fiktionen wieder aufgefüllt wird.


