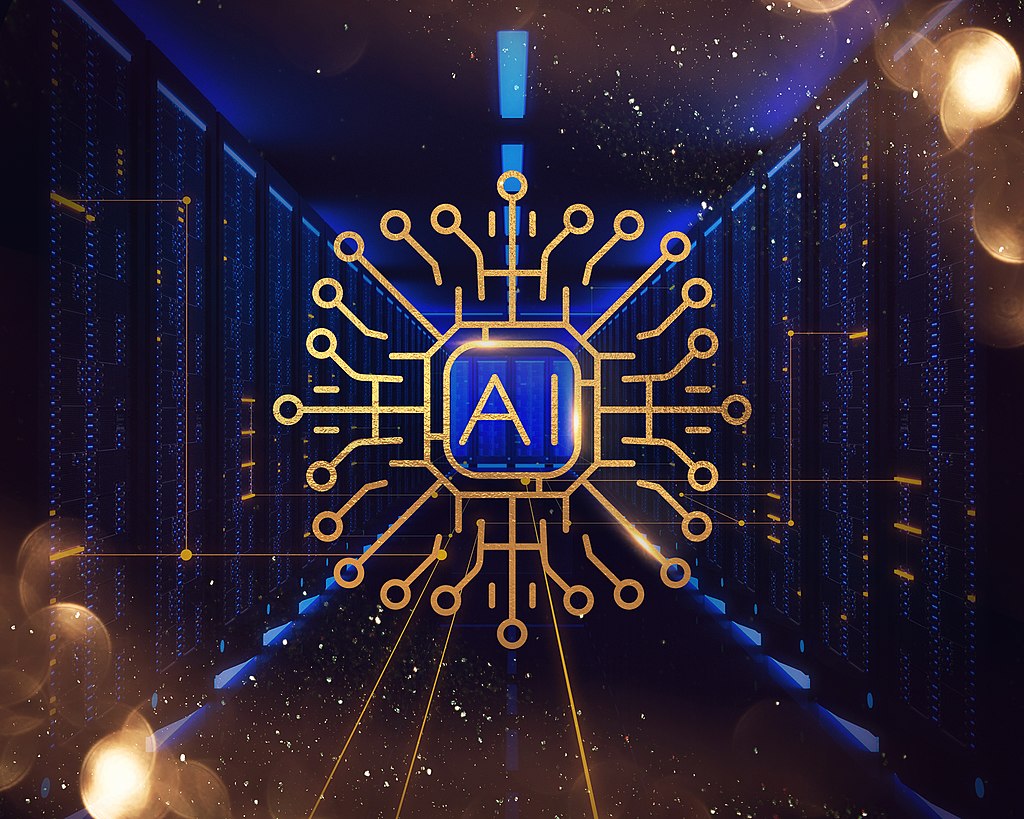Mit dem Peer Mentoring Programm wurde an der FernUni ein Angebot für Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen geschaffen. Das Programm ist Teil von StudyFIT, das alle Angebote rund um die Studieneinstiegsphase und auch für den weiteren Verlauf des Studiums bündelt. Die Zielgruppe des Programms bildet rund 12% der Studierenden der FernUni, das sind etwa 9000 Studierende. Wir haben mit der Programmkoordinatorin Noëmi Gemicioğlu über das Programm, die Nachfrage bei den Studierenden und Herausforderungen gesprochen.
Alexander Sperl: Das Peer Mentoring Programm richtet sich speziell an Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Wie kam es dazu, dass dieses Programm ins Leben gerufen wurde?
Noëmi Gemicioğlu: Wir wissen aus eigenen, aber auch aus bundesweiten Befragungen, dass diese Studierendengruppe gerade im Studieneinstieg großen oder anderen Herausforderungen gegenübersteht als ihre Kommiliton*innen. Sie wünschen sich daher eine intensivere Unterstützung und Begleitung. Mit dem Peer Mentoring wollen wir auf diesen Bedarf eingehen und die Studierenden zu Beginn des Studiums bestmöglich unterstützen. Wir stellen ihnen erfahrene Studierende zur Seite, die ebenfalls Beeinträchtigungen mitbringen. Sie haben so jeweils eine*n kompetente*n Ansprechpartner*in.
AS: Wie funktioniert das genau mit dem Matching? Wie finden die Studierenden zusammen?
NG: Sowohl die Mentor*innen – die erfahrenen Studierenden – als auch die Mentees – die Studienanfänger*innen – melden sich bei uns an und füllen einen Fragebogen aus, in dem wir verschiedene Aspekte abfragen. Nach Ablauf der Anmeldezeit versuchen wir möglichst stabile Tandems zu bilden. Wir haben uns ganz bewusst gegen eine Windhund-Anmeldestrategie entschieden, weil wir möchten, dass alle Studierenden die gleichen Möglichkeiten haben, an diesem Programm teilzunehmen. Letztendlich geht es darum, dass die gebildeten Tandems sehr gut zueinander passen und auch auf längere Zeit funktionieren. Wir achten dabei auf Parameter wie die Studienrichtung, die Art der Behinderung oder Erkrankung oder gemeinsame Interessen. Wir versuchen natürlich auch, individuelle Wünsche der Teilnehmenden zu berücksichtigen.
AS: Also nehmt ihr das Matching vor und das geht nicht von den Studierenden selbst aus.
NG: Genau, die Studierenden kennen ihre Peers natürlich auch erstmal nicht. Eine der großen Herausforderungen ist, dass wir das Programm digital durchführen. In einer Präsenzveranstaltung, in der viel mehr Raum und Zeit ist sich kennenzulernen, können Mentees und Mentor*innen einander in Ruhe selbst finden. Ein Online-Matching wirft viele Fragen auf und letztendlich geht es an der Stelle auch darum Studierende, die in ihrer Biografie sehr wahrscheinlich bereits negative Vernetzungserfahrungen gemacht haben, zu schützen. Schwierig wäre es auch geworden, wenn wir einen Mentor*innen-Pool digital zur Verfügung gestellt hätten, denn wir wollen natürlich die Persönlichkeitsrechte der Studierenden wahren. Insofern ist das händische Zuordnen die beste Möglichkeit und wir halten natürlich mit beiden Tandempartner*innen noch einmal Rücksprache über unsere jeweilige Matching-Idee. Im Moment läuft das auch sehr gut.
AS: Bei so vielen Studierenden als potenzieller Zielgruppe ist die Nachfrage nach dem Programm wahrscheinlich auch ziemlich hoch.
NG: Ja, wir freuen uns über eine wirklich große Nachfrage durch die Studierenden. Wir waren überwältigt von der Anzahl der Mentor*innen, die das Programm unterstützen und ihre Erfahrungen an die Kommiliton*innen weitergeben wollen. Wir haben uns entschieden, die Zahl der Tandems im ersten Durchgang zu begrenzen, damit wir sie bei Fragen oder Schwierigkeiten auch weiter gut begleiten können. Außerdem soll die Veranstaltung für die Studierenden noch gut erlebbar sein und es soll nicht so eine große Anonymität entstehen, bei der sich die Hälfte hinter den berühmten schwarzen Kacheln versteckt. Jede*r soll die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen und einzubringen. Auf der anderen Seite erleben wir eine hohe Nachfrage durch die Mentees und entwickeln gerade Ideen, wie wir auf diesen Bedarf reagieren können.
AS: Kannst du Zahlen nennen, wie viele von denen, die interessiert sind, momentan einen Platz im Mentoring Programm bekommen?
NG: Ich glaube, dass wir gut ein Viertel der Anfragen bedienen können, die sich bei uns schriftlich gemeldet haben. Darüber hinaus gibt es aber noch sehr viel mehr unverbindliche Anfragen oder Anfragen, bei denen wir gemeinsam herausfinden, dass das Mentoring aktuell nicht die geeignete Form der Unterstützung ist. Das bedeutet natürlich leider auch, dass momentan drei Viertel der Anfragen nicht angenommen werden können. Das ist schade, weil wir sowohl von Mentor*innen- als auch von Mentees-Seite Rückmeldungen bekommen, wie toll sie das Angebot finden. Die Mentor*innen sagen, dass sie sich auch selbst so ein Programm für ihren Studienanfang gewünscht hätten. Alle finden es gut, dass sie einen großen Raum für Austausch und Ratschläge haben. Wir unterstützen das, indem wir innerhalb des Programms bewusst auch informelle Räume zur Verfügung stellen, wo einfach ein Schutzraum gewährleistet ist, in dem sich die Teilnehmenden austauschen und Netzwerke aufbauen können.
AS: Du hast als Herausforderung die Persönlichkeitsrechte genannt. Das ist ja nicht nur bei den Mentor*innen sondern auch bei den Mentees in dieser Studierendengruppe noch mal mit speziellen Aspekten belegt.
NG: Ich glaube, dass wir im Bereich Inklusion immer viele sensible Thematiken streifen. Was mir direkt zum Anfang aufgefallen ist, ist die Frage des Wordings. Es ist in diesem Bereich sehr wichtig, bewusst die richtigen Begriffe zu verwenden, um einzelne Personen nicht zu verletzen oder unbewusst einzelne Gruppen auszuschließen. Das ist eine große Herausforderung, die mich die ganze Zeit begleitet. Das andere ist der Spagat zwischen dem Abfragen der Informationen, die wir zum Matching der Tandems benötigen, und dem Aufbauen von Vertrauen, das uns die Studierenden dazu entgegenbringen müssen. Das versuchen wir so gut wie möglich in den Anmeldeprozessen und den Beratungsgesprächen aufzufangen. Die größte Sorge der Studierenden ist immer wieder, dass die Informationen irgendwo zentral erfasst werden und sie eingesehen werden können. Sie haben Angst, dass sie sozusagen den Stempel ihrer Behinderung oder Erkrankung tragen müssen und dass das über das Programm hinaus auch in andere Bereiche der Uni gelangt. Das zeigt mir, dass die Befürchtung besteht, dass noch nicht überall ein Klima geschaffen wurde, in dem es in Ordnung ist, offen über eine Behinderung oder Erkrankung zu sprechen. Wir müssen diese Sorgen sehr ernst nehmen und nehmen uns die Zeit darauf einzugehen. Häufig ist es so, dass eine Behinderung oder Erkrankung nicht sofort erkennbar ist. Dadurch sind die Studierenden in der Situation, einerseits nicht als Studierende mit Behinderung oder Erkrankung wahrgenommen zu werden, andererseits aber sehr große Bedenken haben, damit offen umzugehen, weil sie fürchten, dass ihnen Nachteile daraus entstehen. Das ist eigentlich nur eine Ableitung unserer gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen, die sich dann auf die Uni ausweiten. Ich glaube, dass wir noch stärker daran arbeiten müssen, dass ein Klima entsteht, das diese Zwickmühle gar nicht erst möglich macht.
AS: Die Gruppe der Studierenden mit Behinderung oder Erkrankung ist ja wahrscheinlich auch eine sehr heterogene Gruppe, weil sich die unterschiedlichen Einschränkungen sehr voreinander unterscheiden und auch sehr unterschiedliche Konsequenzen haben.
NG: Das ist auch für uns eine wirkliche Hürde, auf die wir eingehen müssen. Wir realisieren eine Reihe von Veranstaltungen mit einer sehr gemischten Teilnahmegruppe. Wir arbeiten mit einer Schriftdolmetscherin, wir sind bemüht, alle Informationsmaterialien barrierefrei zu gestalten, aber es geht auch darum, Teilnehmende mit Konzentrationsschwierigkeiten die Möglichkeit zur Entspannung zu bieten oder wie wir die Veranstaltung gut gestalten können, dass Teilnehmende mit psychischen Beeinträchtigungen oder aus dem Autismusspektrum gut partizipieren können. Das ist eine sehr spannende Herausforderung, die in einem Präsenzrahmen noch einmal ganz anders aussieht als in einer digitalen Veranstaltung, in der Reaktionen und Feedback der Teilnehmenden häufig nicht so unmittelbar wahrnehmbar sind.
AS: Das ist ja auch insofern interessant, als dass ihr mit dieser Veranstaltung einen Erfahrungspool aufbaut, wie auf verschiedene Beeinträchtigungen reagiert werden kann. Das sind Erfahrungen, die auch auf andere Lehrveranstaltungen angewendet werden können.
NG: Ich denke, das ist einfach eine gute Chance für uns, einen geschützten Erfahrungsraum zu haben, in dem wir offen darüber kommunizieren können. Wir können uns fragen, wie wir das gemeinsam gut hinbekommen, welche Absprachen wir für die Zusammenarbeit brauchen, damit alle gut teilhaben können. Ich glaube, dass nicht nur die Studierenden viel dabei lernen, sondern dass auch die FernUni davon viel mitnehmen kann. Und da ist eben ein guter Weg die offene Kommunikation. Ich habe viele intensive Gespräche mit den Mentor*innen geführt, in denen ich das Konzept vorgestellt habe und da habe ich ganz viele positive Rückmeldungen erhalten. Was ich außerdem als besonders positiv erlebe ist das Vertrauen, das die Studierenden in uns als Hochschule oder auch mir in der Koordinatorinrolle entgegenbringen. Dadurch werden die unterschiedlichen Bedarfe offen kommuniziert und wir erhalten die Chance darauf einzugehen. Ich denke auch, dass wir das sammeln und dokumentieren müssen, damit die Universität daraus lernen kann und bei uns Barrieren abgebaut werden können.
AS: Das ist fast schon ein perfektes Schlusswort, ich möchte aber trotzdem noch wissen, was für die Zukunft geplant ist.
NG: Wir sind jetzt natürlich noch ein bisschen in der Ausprobier-Phase im ersten Durchgang des Programms. Uns sind aber schon ein paar Dinge aufgefallen, die wir noch angehen möchten. Z. B. gibt es eine sehr geringe Beteiligung männlicher Studierender, da wäre eine Aufgabe das zu hinterfragen, warum das so ist. Dann wird es auch darum gehen, die Fakultäten mehr ins Boot zu holen und das Projekt dort noch mal besser zu kommunizieren. Wir haben gesehen, dass sich Studierende bestimmter Fachgruppen besonders für das Programm interessieren. Und in der weiteren Zukunft könnte es z.B. um die Frage gehen, wie die Begleitung von Menschen mit Behinderung oder Erkrankung über den gesamten Studienverlauf aussehen kann. Da gibt es noch mehr sensible Phasen, wie z. B. Prüfungen, die wir in den Fokus rücken sollten.