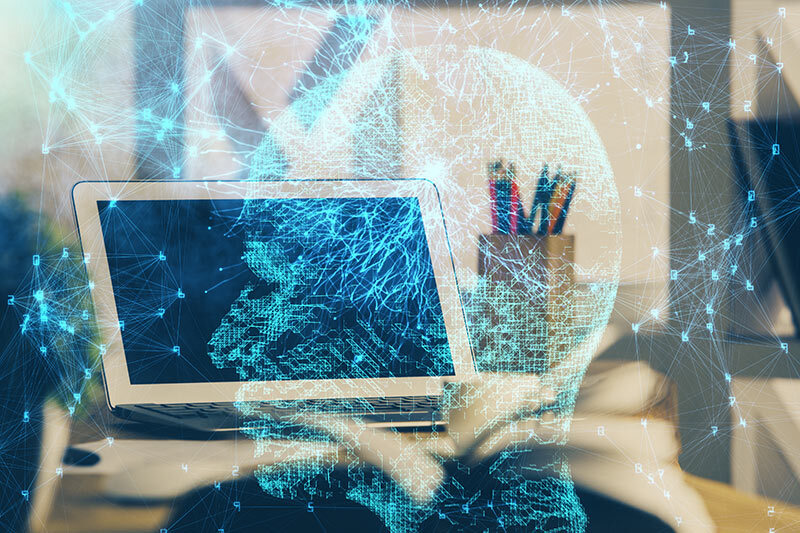„Wie gestalten wir verantwortungsvolle Innovation?“
Im Doppelinterview sprechen die Informatikerin Prof. Lena Oden und der Psychologe Prof. Marcus Specht über High-Performance-Computing, Lernforschung im Reallabor und Verantwortung.
 Foto: Volker Wiciok
Foto: Volker Wiciok
Ein neuer Supercomputer, er ist der schnellste Europas, eine neue Version von ChatGPT, ab jetzt mit weniger Halluzinationen – das Tempo, mit dem sich die Technologien weiterentwickeln, ist rasant. Was das für Forschung und Lehre bedeutet und wie diese sich sinn- und verantwortungsvoll nutzen lassen, darüber sprechen die Informatikerin Prof. Dr. Lena Oden und der Psychologe Prof. Dr. Marcus Specht im Interview.
Woran forschen Sie aktuell?
Lena Oden: Ich bin von Haus aus Rechnerarchitektin, das heißt, Hochleistungsrechnen ist mein eigentlicher Hintergrund. Ich gucke mir Programmiersprachen an, mit denen man Hochleistungsrechner sinnvoll benutzen kann, Laufzeitsysteme und neuartige Rechenarchitekturen. Außerdem bin ich mit einem Fuß noch am Forschungszentrum in Jülich. Im EBRAINS 2.0-Projekt, in dem es um den Aufbau einer Forschungsinfrastruktur für Digital Brain Research geht, bin ich verantwortlich dafür, die Recheninfrastruktur zu integrieren. Ich helfe den Neurowissenschaftler:innen, die Hochleistungsrechner und neuromorphen Systeme zu nutzen.
Marcus Specht: Ich beschäftige mich vor allem damit, wie wir neue Technologien, Medien, aber auch andere Technologien, zur Unterstützung von Lehren und Lernen einsetzen können. Zum einen beschäftige ich mich mit dem Design dieser Technologien sowie Medien und zum anderen mit der Wirkungsforschung dazu. Also was funktioniert wann und warum? Das machen wir im Forschungszentrum CATALPA. Meine Forschung ist daher immer interdisziplinär. Wir arbeiten mit Wissenschaftler:innen aus der Informatik, Psychologie, Computerlinguistik, Bildungswissenschaft und Organisationssoziologie zusammen. Dabei arbeiten wir nach dem Reallabor-Prinzip: Direkt in der Praxis der FernUni forschen wir an technischen und didaktischen Entwicklungen und übertragen die Ergebnisse dann in den Hochschulbetrieb.
 Foto: Volker Wiciok
Foto: Volker Wiciok
Zur Person: Prof. Dr. Lena Oden
Die Informatikerin ist Leiterin des Lehrgebiets Technische Informatik. Sie erforscht moderne Rechnerarchitekturen. Ihr Fokus liegt auf dem Hochleistungsrechnen, dessen Anwendungen, Programmiermethoden und Laufzeitsystemen.
Gibt es bei Ihren Forschungen Schnittstellen oder Berührungspunkte?
Specht: Ich habe vorher an der Technischen Universität in Delft gearbeitet. Im Quantum Computing Center werden dort neue Programmier-Frameworks entwickelt, um Quantencomputer zu programmieren, aber auch User Interfaces oder Erklärungen kreiert, damit Laien verstehen, was ein Quantencomputer überhaupt ist.
Oden: Das kommt meiner Arbeit schon nah. Ich mag zwar Hardware und mag es, mich wirklich mit den Details auseinanderzusetzen. Aber ich arbeite auch interdisziplinär und die Neurowissenschaftler:innen müssen die Hardware benutzen können, was nicht immer so einfach ist. Neuromorphe Systeme sind zum Beispiel eine andere Rechenart, die mehr funktioniert wie das menschliche Gehirn. Das versuche ich, den Leuten verständlich zu machen. Dort gibt es wahrscheinlich Anknüpfungspunkte.
Specht: Also verstehe ich dich richtig, dass ihr von der Hardware bei den neuromorphen Systemen schon näher an dem Vorbild menschliches Gehirn dran seid als bei den klassischen Large-Language-Modellen?
Oden: Ja, deutlich näher. Sie helfen aber mehr dabei, die Funktionalität des menschlichen Gehirns zu verstehen. Die klassischen Large-Language-Modelle auf konventioneller Hardware sind aktuell leistungsstärker als die Systeme, die in der Struktur näher am menschlichen Gehirn dran sind.
 Foto: Volker Wiciok
Foto: Volker Wiciok
Zur Person: Prof. Dr. Marcus Specht
Der Psychologe leitet die Forschungsprofessur Learning Sciences in Higher Education am Forschungszentrum CATALPA. Er ist Mitglied im Leitungsteam des Forschungszentrums und entwickelt unter anderem Methoden und Verfahren, die Lehrende und Lernende bei der Nutzung generativer KI unterstützen. fernuni.de/catalpa
Large-Language-Modelle werden in Zukunft also vermutlich weiterhin omnipräsent sein. Was bedeutet das für Lehre und Forschung?
Specht: Wenn man mit den Infos, die sie liefern, kritisch umgeht, sind sie sehr mächtige Instrumente. Mich interessiert dabei besonders die Frage, was sie mit dem Lernprozess von Menschen machen. Aus meiner Sicht wird dieser Prozessaspekt bei der Entwicklung von Large-Language-Modellen oder KI-Modellen im Moment oft nicht berücksichtigt. Es geht hauptsächlich um die Optimierung der Performanz. Die Wirkung des Modells in einem menschlichen Benutzungskontext ist oft nicht erforscht. Das ist ein allgemeines Problem in der Lehr-Lernforschung. Im Moment gibt es nur den großen Hype, dass wir mit den nächsten fünf Versionen von ChatGPT alles lösen können und eine AGI (Artificial General Intelligence) haben. Da würde mich deine Meinung interessieren, wie siehst du das?
Oden: Ich glaube, dass es den Arbeitsalltag und wie wir lehren und lernen komplett verändern wird und dass andere Fähigkeiten entscheidender werden. Ich finde, es sind sehr mächtige Tools. Aber ich glaube nicht, dass sie allmächtig werden. Ich glaube, dass der Mensch als Schnitt-stelle weiterhin wichtig sein wird. Aber einen großen Wandel wird es in den nächsten Jahren geben. Die Frage ist halt, wie man den Leuten einen verantwortungsvollen Nutzen beibringt und dann hinbekommt, dass sie nicht zu denkfaul werden. Das wird für mich in den nächsten Jahren die größte Herausforderung werden: Wie gestalte ich meine Lehre, dass die Leute trotzdem noch lernen, eigenständig zu denken?
Die Frage ist, wie man den Leuten einen verantwortungsvollen Nutzen beibringt, und es dann hinbekommt, dass sie nicht denkfaul werden.
Prof. Lena Oden
Sollte denn alles, was technisch möglich ist, auch umgesetzt werden?
Oden: Ich finde es immer schwierig zu sagen, wo die Grenze gesetzt wird, und muss mich da auch selbst kritisch hinterfragen: Was ist nur meine persönliche Abneigung, und was ist wirklich problematisch? Vereinfachung ist zum Beispiel gut, aber man sollte Lernende nicht von jeder Herausforderung befreien. Denken und Wissen zu fördern, finde ich essenziell.
Specht: Also ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Innovation ist oft technologiegetrieben. Dann heißt es schnell: ,Social Media macht süchtig, also weg damit.’ Das halte ich für gefährlich, weil es Diskussionen abwürgt. In den Niederlanden habe ich erlebt, wie man viel offener mit Innovationen umgeht. Sicherlich ist nicht alles sinnvoll, aber wir brauchen ein Gespür für die Möglichkeiten – statt von vornherein nur die Gefahren zu sehen. Wir sollten versuchen, besser zu verstehen, bei welchem Prozess oder bei welcher Entwicklung bestimmte Technologien Vorteile bringen können.
Oden: Da stimme ich zu. Ich war anfangs auch skeptisch gegenüber manchen Technologien. Aber es gibt Kontexte, in denen sie sinnvoll sind – gerade in der Fernlehre, wo Interaktion fehlt. Wichtig ist es, den Mittelweg zu suchen und kritisch zu prüfen, wo Technik wirklich Mehrwert bringt.
Specht: LEAD:FUH ist da ein gutes Beispiel. Bei dem Projekt ist der Fokus auf Learning Analytics, also der Verwendung von Daten über Lernprozesse, um entweder Lehrende oder Lernende zu unterstützen. Hier schauen wir nicht nur, was technisch funktioniert. Wir testen auch, was in kleinem Rahmen einen bestimmten Effekt erzeugt und anschließend, ob sich dieser hochskalieren und auf die gesamte Lehre ausrollen lässt.

Beitrag aus dem Wissenschaftsmagazin fernglas 2025/2026.
Zur Ausgabe
Binden Sie Studierende eigentlich aktiv bei der Entwicklung neuer Lerntools mit ein?
Oden: Beim Hochleistungsrechnen sitzt man immer noch sehr viel vor einer schwarzen Konsole und tippt Befehle ein. Ich persönlich finde das nicht schlimm, aber es schreckt viele Leute ab. Darum arbeiten wir zum Einstieg mit Jupyter Notebooks. Wir haben dort die Umgebung um zusätzliche Features erweitert, welche zum Beispiel die Performance besser visualisieren. Darüber habe ich schon mehrere Abschlussarbeiten schreiben lassen. Darin haben die Studierenden es weiterentwickelt, sich aber auch gleichzeitig damit auseinandergesetzt, was dahintersteckt. Denn das ist mir sehr wichtig. Ich möchte trotzdem, dass sie den Hintergrund verstehen.
Specht: Ich mache das auch in allen Phasen des Studiums. Bei Masterarbeiten hatten wir zum Beispiel einen ähnlichen Ansatz. Wir haben auch Jupyter Notebooks zum Programmieren lernen in der Statistik im Einsatz. Die Masterstudierenden machen dann Variationen dieser Lernumgebung und untersuchen, welche Möglichkeiten und welche Nach- und Vorteile sie bieten.
Wir sollten versuchen, besser zu verstehen, bei welchem Prozesse bestimmte Technologien Vorteile bringen.
Prof. Marcus Specht
Spielt dabei die berufliche Erfahrung, die FernUni-Studierende häufig mitbringen, eine Rolle?
Oden: In der Informatik haben wir viele Quereinsteiger, die keinen technischen Hintergrund haben. Da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied, wie die Leute an Probleme herangehen.
Specht: Ich finde es auch superspannend, die Historie der Studierenden mitzunehmen. Wenn sie für Abschlussarbeiten mit einem Problem aus ihrem Arbeitsalltag kommen und das mit der Methode, die sie im Studium gelernt haben, anpacken möchten, sind sie meistens top motiviert, wissen viel über den Kontext und haben ein echtes Bedürfnis, ein praktisches Problem zu lösen.
Oden: Ich glaube, es ist wirklich eine große Chance der FernUni, dass wir so viele unterschiedliche Studierende haben. Es ist ein unglaublicher Korpus an Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, ein wahrer Schatz, den wir nutzen sollten.